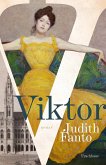Eine verrückte Familiengeschichte, weltumspannend, voll jüdischem Witz
Samuel Leiser ist ein einsamer Vogel. Sein Vater Yehuda entkam den Nazis, indem er vorgab, Autor zu sein und als Künstler nach Amerika einreisen durfte - wo er zum gefeierten Kriminalschriftsteller Jonathan Still wurde. Nun übersetzt Samuel seine Bücher ins Deutsche. Zwischen den Zeilen sucht und findet er versteckte Botschaften. Doch was bedeuten sie?
In einem Sommer Anfang der Siebziger zieht Samuels frühreife Tochter Ashley aus England zu ihm nach Paris, damit sich beide einmal in Ruhe kennenlernen. Bald aber wird es eng in der kleinen Wohnung: Samuels Ex-Frau Letitia kommt mit Vater und neuem Freund zu Besuch. Durchreisende bleiben länger als erwartet, sogar Yehuda fliegt samt Gangster-Verwandtschaft ein. Dem turbulenten Familientreffen zwischen Eheschwüren und Eifersuchtsdramen entkommt Samuel nicht einmal, indem er sich in seine Spanischlehrerin verliebt. Denn nicht nur die Menschen seines Lebens überfallen ihn, sondern auch ihre Geschichten und ererbten Alpträume - bis zum furiosen Finale.
Martin Kluger erzählt eine drei Generationen umspannende Geschichte um die Liebe: eine melancholisch-ironische Comedie humaine.
Samuel Leiser ist ein einsamer Vogel. Sein Vater Yehuda entkam den Nazis, indem er vorgab, Autor zu sein und als Künstler nach Amerika einreisen durfte - wo er zum gefeierten Kriminalschriftsteller Jonathan Still wurde. Nun übersetzt Samuel seine Bücher ins Deutsche. Zwischen den Zeilen sucht und findet er versteckte Botschaften. Doch was bedeuten sie?
In einem Sommer Anfang der Siebziger zieht Samuels frühreife Tochter Ashley aus England zu ihm nach Paris, damit sich beide einmal in Ruhe kennenlernen. Bald aber wird es eng in der kleinen Wohnung: Samuels Ex-Frau Letitia kommt mit Vater und neuem Freund zu Besuch. Durchreisende bleiben länger als erwartet, sogar Yehuda fliegt samt Gangster-Verwandtschaft ein. Dem turbulenten Familientreffen zwischen Eheschwüren und Eifersuchtsdramen entkommt Samuel nicht einmal, indem er sich in seine Spanischlehrerin verliebt. Denn nicht nur die Menschen seines Lebens überfallen ihn, sondern auch ihre Geschichten und ererbten Alpträume - bis zum furiosen Finale.
Martin Kluger erzählt eine drei Generationen umspannende Geschichte um die Liebe: eine melancholisch-ironische Comedie humaine.

Wie entbrimborisiert man eine Familie? In Martin Klugers neuem Roman "Der Vogel, der spazieren ging" entwickelt ein jüdisches Küken großen Appetit auf die dunklen Seiten ihrer Ahnengeschichte.
Von Wolfgang Schneider
Das jüdische Leben mit seinen osteuropäischen Wurzeln hat es Martin Kluger angetan. In "Der Koch, der nicht ganz richtig war" spannte der 1948 geborene Autor zuletzt ein eigenwilliges Universum der Emigration auf und erzählte von Menschen, die zu Umhergetriebenen und großen "Länderverlassern" wurden. Den Geschichten der Verfolgungen mischte er eine gute Prise Märchenaroma bei; das Ergebnis erinnerte - bei aller Eigenständigkeit - teils an die "Zimtläden" des Bruno Schulz, teils an die feine Kunstgewerblichkeit eines Chagall.
"Der Vogel, der spazieren ging" nimmt jetzt nicht nur den Rhythmus des früheren Titels, sondern auch den Faden des Geschehens auf und lässt einige Figuren wiederkehren, ohne dass die Kenntnis der früheren Erzählungen zum Verständnis nötig wäre. Der Märchenton wird zurückgenommen und stattdessen eine Tragikomödie angerichtet. Im Mittelpunkt steht eine übermächtige Vaterfigur, die es sich leisten kann, erst im letzten Viertel des Romans persönlich aufzutreten: Yehuda Leiser, der Sonnengott einer über die Welt verstreuten Familie. Vor den Nazis konnte er sich hinüber in die Staaten retten, wo er die Vergangenheit abschüttelte und sich Jonathan Still nannte. Ein Name, der bald für kriminalistische Qualitätsprodukte stand - Still erschrieb sich ein Vermögen mit den Romanen um den Detektiv Paul Perrone, eine schlagkräftige Symbolfigur, die antritt, eine Welt, in der sich "friedliche Nachbarn" in "bösartige Oger" verwandeln, immer wieder einzurenken.
Sohn Samuel Leiser, der Ich-Erzähler des Romans, laboriert am Berühmter-Vater-Komplex. Er flieht vor dem breiten Schatten des Erzeugers nach Paris und schlägt sich dort durch - als einer von neunundzwanzig Perrone-Übersetzern. Seine Beziehung mit der uruguayischstämmigen Regisseurin Letitia Weintraub, die ebenfalls einer jüdischen Familie enstammt und den Lebenskünstler Ludovico Weintraub (noch in amüsanter Erinnerung aus dem Erzählband) zum Vater hat, ist in die Brüche gegangen, die gemeinsame Tochter Ashley lebt bei der Mutter in England. Dennoch gibt sich Sam als Erzähler durchaus nicht kleinlaut, sondern pflegt einen aufgekratzten, elaborierten Tonfall. Soll heißen: Er könnte der eigentliche Schriftsteller der Familie sein, wenn er nicht ein Vogel wäre, der spazieren geht - weil er unter Flugangst leidet.
Die Handlung kommt in Gang, als sich eines schönen Sommers in den frühen siebziger Jahren Ashley beim Vater in Paris einquartiert. Ein Pubertätskrach mit der Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten, dem eitlen Star-Schauspieler Ringold Schneider, scheint der zureichende Anlass. Aber bald spürt man: Da ist ein Projekt in Gang. Ashley ist versessen auf alles Jüdische, kocht "Tzimmes und Kugels", und vor allem hat sie den großen Hunger auf Familiengeschichte. Eine Geschichte ist das, dunkel grundiert von den Lagern und der Auslöschung. Dunkel auch deshalb, weil aufgrund der biographischen Schnitte der dreißiger Jahre das Vorleben entrückt ist - eine mythische Vorzeit, die schon eine reiche Mitgift an Kränkungen und "Kuddelmuddel" im Gepäck hatte, kaum greifbar für die Nachgeborenen. Aber Ashley will endlich wissen, was gespielt wird und die jüdischen Fundamente des schiefen Familienbaus freilegen.
Im Folgenden werden verschlossene Tagebücher aufgebrochen und ein Attentat auf ein wertvolles Cello verübt. Eine "liebestolle Germanin" namens Hildegard stellt dem Ich-Erzähler nach, der am Ende beinahe noch durch einen heimtückischen Stoß in die Baugrube von Les Halles ermordet wird. Das Töchterchen verschwindet, dafür taucht Ringold Schneider, der "Herr der Tränendrüsen", in Paris auf, und bald stellt sich die gesamte "Mishpoche" aus allen Enden der Welt ein. Schließlich fährt Jonathan Still höchstselbst vor, mitsamt seiner neuen Lebensgefährtin Rahel, einer Bestsellerautorin. Sams Wohnung wird zur Komödien-Karawanserei, zur Station für "durchreisende Gespenster". Gelegentlich schaut auch der Tod fürsorglich um die Ecke und versichert auf seine unnachahmlich belebende Weise: "Falls ihr mich vergessen haben solltet, ich bin immer für euch da."
"Beschreibung ist Sehnsucht", heißt es an einer Stelle. Und: "Küchen sind Backstuben der Erinnerung." So wird in diesem Roman gekonnt beschrieben und zünftig gebacken - nur geht der Erinnerungskuchen irgendwie nicht richtig auf. Kein Zweifel, ein Roman, der sich mit lange nachwirkenden Familientraumata beschäftigt, der die Wiederkehr des Verdrängten, wie stockend auch immer, in Gang setzt und von der Suche nach Vätern erzählt, die lieber nicht gefunden sein wollen - ein solcher Roman hat die Psychologie zur Mutter. Zugleich aber pflegt Kluger ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem literarischen Psychologisieren. Die gebahnten Wege des Verständnisses will er seine Figuren nicht gehen lassen und lässt vieles lieber im Unausgesprochenen, ganz wie Jonathan Still, der auf die familiäre Neigung zu Albträumen mit dem beschwichtigenden antifreudianischen Bonmot reagiert, Träume seien nichts als "Müllhalden um Mitternacht".
So mehren sich die Zeichen, aber wofür stehen sie? So wächst der Müllberg, aber wer holt ihn ab? Bei aller Turbulenz des Geschehens fährt die Familientragikomödie gleichsam mit angezogener Handbremse. Auch wenn am Ende tatsächlich noch Psychodrama und "Familienaufstellung" gespielt und alte Tränen dabei hochgepumpt werden - es bleibt eine halbherzige Rückkehr in die Vergangenheit, bei der die Reiseapotheke freilich gut gefüllt ist: Marihuana, Valium und viel Alkohol.
Bevor er sich mit den Romanen "Abwesende Tiere" und "Die Gehilfin" als markante Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur etablierte, hat Kluger Drehbücher geschrieben. Das routinierte Gespür für den Aufbau von Szenen und Dialogen ist auch seinem Roman anzumerken, dessen Plot an die Tradition der Screwball-Komödie à la Lubitsch erinnert. Hinzu kommen eminente Prosa-Qualitäten: eine Sprache, die an den extravaganten Stil Nabokovs erinnert, von dessen "walking birds" aus dem Roman "Sieh doch die Harlekine" der Titel inspiriert ist. Englische, französische, spanische oder jiddische Zungenschläge tragen zur Sprachmusik des Romans ebenso bei wie ein außerordentliches Rhythmusgefühl im Satzbau. Bisweilen stört man sich allerdings an gewollter Originalität, an Worten wie "entbrimborisiert" oder "Plapperistencafé".
Alle glücklichen Familien seien einander ähnlich, jede unglückliche aber auf ihre ganz eigene Art unglücklich, befand Tolstoi. In Klugers Roman geht die Eigenwilligkeit im Unglücklichsein allerdings so weit, dass man sich bisweilen fragt, warum man sich für die Querelen all dieser "phantastischen Leute" interessieren soll. Verfolgt Kluger nicht, mit viel erzählerischem Aufwand, eine Privatmythologie? Man muss sich vom Erzähler Samuel Leiser gewissermaßen adoptieren lassen für die Lektüre. Mit dem solcherart begründeten Verwandtschaftsgefühl wird man Anteil nehmen an Klugers sorgsam gehegten Schicksalsgestalten.
- Martin Kluger: "Der Vogel, der spazieren ging". Roman. Dumont Verlag, Köln 2008. 318 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die herzzerreißende Komik dieses Totentanzes schöpft Martin Kluger aus dem Stoff der Träume: Kinostoff, zusammengesetzt aus leuchtenden Einfällen, Sentenzen und Verweisen von Danny Kaye bis William Shakespeare und souverän kombiniert mit den Mitteln des klassischen Entertainment."
NZZ
"So beschwingt erzählen nur wenige vom Schweren und Unberechenbaren: 'Der Vogel, der spazieren ging' hebt tatsächlich ab, wenn er seine Hauptfigur mit gestutztem Gefieder durch die große Stadt Paris und seinen Vater-Sohn-Konflik torkeln lässt. [...] Wie schwer ist es, eine Identität wieder aufzubauen, wenn sie einem erstmals genommen wurde, auch davon spricht dieser Roman dieses wunderbar sprachstilistischen, fantasiebegabten Erzählers."
DER TAGESSPIEGEL
"Martin Kluger erzählt eine 'verfremdete Familiengeschichte' - temporeich und mit viel Witz. [...] Ein Soufflé sei sein neuer Roman, 'ein Soufflé, in dem ein paar Giftpfeile stecken': leicht, luftig und gehaltvoll. [...] Martin Klugers neuer Roman, ist zweifelsohne sein bislang amüsantester - allen 'Giftpfeilen' zum Trotz."
KÖLNER STADT-ANZEIGER
"Ein Buch voller Heiterkeit und Lebenswitz [...] Die Schönheit dieses Romans resultiert geradewegs aus eine Überdosis - von Witz, Heiterkeit, Imagination und anderen Zutaten. [...] Aber es gelingt ihm, eine Welt zu entwerfen, die niemals konstruiert oder bloß erdacht wirkt, eine tiefe, dichte Welt, in die man sich als Leser am Liebsten hinein kopieren würde."
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
NZZ
"So beschwingt erzählen nur wenige vom Schweren und Unberechenbaren: 'Der Vogel, der spazieren ging' hebt tatsächlich ab, wenn er seine Hauptfigur mit gestutztem Gefieder durch die große Stadt Paris und seinen Vater-Sohn-Konflik torkeln lässt. [...] Wie schwer ist es, eine Identität wieder aufzubauen, wenn sie einem erstmals genommen wurde, auch davon spricht dieser Roman dieses wunderbar sprachstilistischen, fantasiebegabten Erzählers."
DER TAGESSPIEGEL
"Martin Kluger erzählt eine 'verfremdete Familiengeschichte' - temporeich und mit viel Witz. [...] Ein Soufflé sei sein neuer Roman, 'ein Soufflé, in dem ein paar Giftpfeile stecken': leicht, luftig und gehaltvoll. [...] Martin Klugers neuer Roman, ist zweifelsohne sein bislang amüsantester - allen 'Giftpfeilen' zum Trotz."
KÖLNER STADT-ANZEIGER
"Ein Buch voller Heiterkeit und Lebenswitz [...] Die Schönheit dieses Romans resultiert geradewegs aus eine Überdosis - von Witz, Heiterkeit, Imagination und anderen Zutaten. [...] Aber es gelingt ihm, eine Welt zu entwerfen, die niemals konstruiert oder bloß erdacht wirkt, eine tiefe, dichte Welt, in die man sich als Leser am Liebsten hinein kopieren würde."
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Viel Sympathie, auch Bewunderung für das Talent Martin Klugers legt der Rezensent Wolfgang Schneider an den Tag. So richtig glücklich geworden ist er mit dem Roman aber trotz eigentlich stimmiger Ingredienzien nicht. Entfaltet wird, teils anschließend an den Erzählband "Der Koch, der nicht ganz richtig war", die Geschichte eines übermächtigen Vaters, unter dessen Ruhm als Krimiautor der ich-erzählende Sohn Samuel Leiser zu leiden hat. Dessen Tochter wiederum entwickelt einen Enthusiasmus für alles, was jüdisch ist - und damit auch für die Geschichte ihrer Familie. Verdrängtes tritt zutage, mal komödiantisch, mal eher tragisch. Zugleich misstraut, so Schneider, der Autor der Psychologie, weshalb vieles bedeutungsvoll scheint, ohne dass die Bedeutung ganz klar wird. Bei allem Geschick des ehemaligen Drehbuchautors für den Konfliktaufbau und den "eminenten Prosa-Qualitäten" a la Nabokov zum Trotz: Irgendwie fehlt dem Rezensenten etwas, irgendwie scheint ihm das ganze ein wenig zu sehr konzentriert auf eine "Privatmythologie".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH