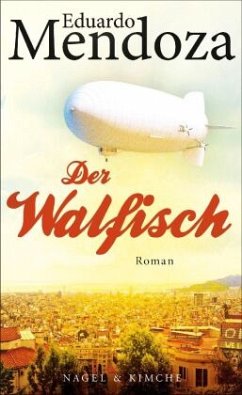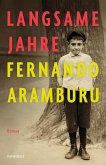Als der Bischof Fulgencio Putucàs 1952 aus Lateinamerika nach Spanien kommt, um in Barcelona an einem eucharistischen Kongress teilzunehmen, wird er von einer Gastfamilie respektvoll aufgenommen. Doch in seinem Heimatland findet ein Militärputsch statt, und Putucàs kann nicht mehr nach Hause - in Barcelona gestrandet, macht er eine kuriose Wandlung durch. Er hilft im Haushalt der Familie und ist bald nicht mehr der ehrwürdige Mann der Kirche, sondern einfach Fulgencio. Dann aber geht er immer öfter auf Sauftour und ist eines Tages verschwunden. Erst Jahre später taucht er wieder auf, und erneut hat er sich komplett verändert. Ein vergnüglicher Roman über die Bilder, die wir uns voneinander machen, und die Überraschungen eines Lebens.

Gestrandet: "Der Walfisch" von Eduardo Mendoza
Die Soutane, der schwarze Umhang, die Schärpe und das schwere silberne Kreuz: der Mann ist seines Amtes würdig. Ein Mensch des Glaubens, ein würdiger Vertreter der katholischen Kirche. Zwar kommt er, leider, aus keinem der großen europäischen Staaten, sondern einem kleinen, kaum bekannten Land in Zentralamerika. Aber daran muss man sich nicht stören, wer will, kann der Aura des Bischofs erliegen. Es war, berichtet der Erzähler, "als wäre eine Figur eines alten Gemäldes in den Raum getreten, die sich auf wunderbare Weise von der Leinwand gelöst hatte und sich, nachdem sie Jahrhunderte lang in einem Museumssaal gehangen hatte, in die Welt der Lebenden wagte".
Und so nimmt Bischof Fulgencio Putucàs nun das Gästezimmer von Tante Conchita und Onkel Víctor in Anspruch. Eine andere Bleibe ist nicht zu finden, denn der Eucharistische Weltkongress, den Barcelona im Mai 1952 beherbergt, sprengt die Kapazität der städtischen Hotelbetten im Handumdrehen. So ist der Bischof, wie manche seiner Kollegen, auf die Gastfreundschaft der Barceloner angewiesen. Und Tante Conchita ist mehr als angetan von der Vorstellung, einen hohen geistlichen Würdenträger einmal aus der Nähe zu erleben. Was folgt, ist eine charmante katalanisch-lateinamerikanische Variante des "Kleider machen Leute"-Motivs.
Denn mit dem Bischof, so viel darf man verraten, hat es so seine Bewandtnis. Nicht dass einige Ungereimtheiten im ersten Moment auffallen würden. Doch weil im (nicht genannten) Herkunftsland des Bischofs gerade ein Putsch stattfindet und der Gottesmann zur persona non grata erklärt wird, zieht sich sein Aufenthalt in der Gastfamilie hin - und bietet hinreichend Zeit, einander kennenzulernen.
"Santos que no lo son", "Heilige, die keine sind", hat Eduardo Mendoza sein Triptychon gefallener Gottesmänner und -frauen genannt. Von den drei Erzählungen ist allein "Der Walfisch" ins Deutsche übertragen worden. Und darum darf man auch das verraten: Auch Bischof Fulgencio Putucàs ist kein Heiliger. Für einen Mann des Glaubens, bemerken die Gastgeber bald, benimmt er sich erstaunlich ungezwungen. Und auch sonst fällt er aus der Reihe. Der damals junge Ich-Erzähler, in der Schule schwächelnd, will sich von dem Würdenträger helfen lassen. Dass der gebildet ist, setzt er voraus. Allerdings muss er sehr bald bemerken, "dass er von keinem Fach auch nur den Hauch einer Ahnung besaß". Und nicht nur dass: Auch sonst ist der Mann unkonventionell. Er schließt sich dem Vater des Erzählers, einem Alkoholiker, an, und ist bald selbst dem Wein ergeben. Und dann bemerkt auch die Familie, dass der Gast es mit den Zehn Geboten nicht so genau nimmt.
Der Bischof freilich, bald unerfreulicher Sünden überführt, sieht sich selbst in reichlich pathetischem Licht. "Der Walfisch", der dem Roman den Titel gegeben hat, ist in jenem Frühjahr 1952 als präpariertes Ausstellungsstück die Sensation in Barcelona. Da ist es nun aufgebahrt, das riesige Säugetier: Sinnbild des gestrandeten Bischofs. Denn wie der Wal sieht sich der Kirchenmann in ein Milieu verpflanzt, in das er nicht gehört - "für ein lächerliches Geld zur Belustigung der Leute ausgestellt".
Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung - man kann sich denken, dass sie gründlich auseinandergehen. Mendozas "Walfisch" ist eine nette, aber zugleich erstaunlich harmlose, ja biedere Fabel über die Hinfälligkeit (angeblich) frommer Seelen. Sie reiht sich ein in die uralte literarische Tradition der Priesterkritik - die sie aber in keinem Punkt erneuert. So hält man eine Geschichte in Händen, von der sich nichts Schlechtes sagen lässt, außer dass sie belanglos ist.
KERSTEN KNIPP
Eduardo Mendoza: "Der Walfisch". Roman.
Aus dem Spanischen von Stefanie Gerhold. Nagel & Kimche, München 2015. 125 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main