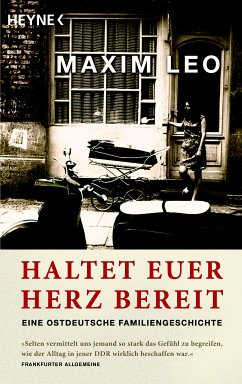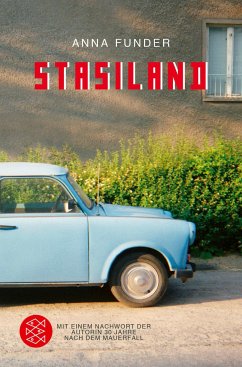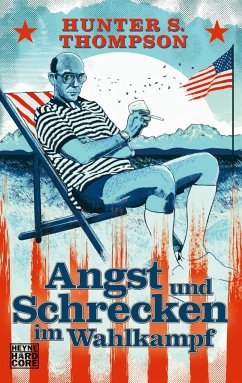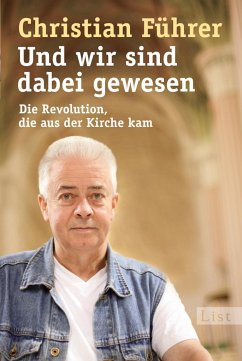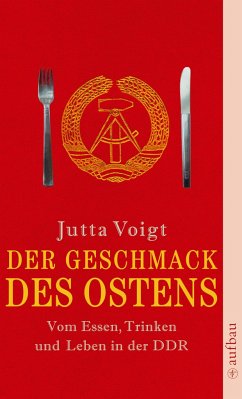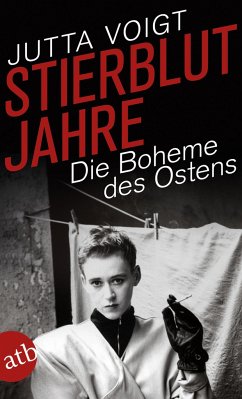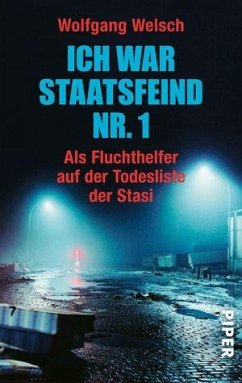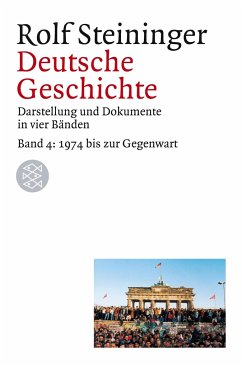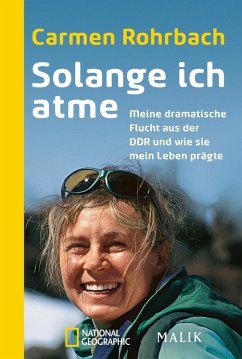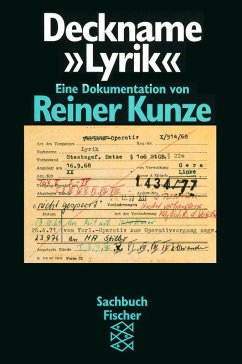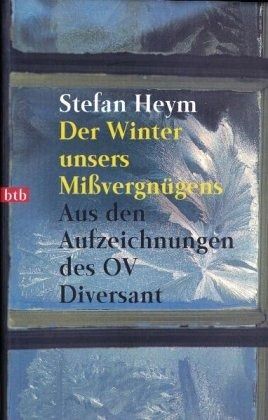
Der Winter unsers Mißvergnügens
Aus den Aufzeichnungen des OV Diversant
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
9,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Auch seine Aufzeichnungen, entstanden zur Zeit der Biermann- Ausbürgerung und ergänzt durch unbekannte Stasi-Dossiers, zeigen die Mechanismen der Einschüchterung und Manipulation des DDR-Staatsapparats auf. Gleichzeitig ist das Buch jedoch ein Beispiel für den Widerstand von DDR- Intellektuellen lange vor der Wende und läßt sich ebenso als persönlicher Erlebnisbericht wie auch als brisantes politisches Lehrstück lesen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.