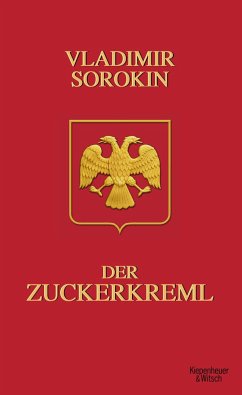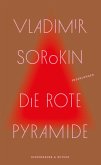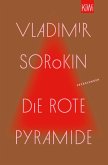Ein furioses Sittengemälde von Russlands Starautor: ein literarischer Extrakt aus Wodka, Schnee und Blut - mit sechs Löffeln Zucker
Russland im Jahr 2028: ein neues Mittelalter, geprägt von Informations- technologie und Massenarmut. Körperliche Züchtigung ist an der Tagesordnung. In einem gewaltigen Stimmenchor führt Sorokin den Leser durch die dunklen Seitengassen des Lebens in einem utopischen Russland, das er dem heutigen wie einen Zerrspiegel vorhält.
In fünfzehn virtuosen Kurzerzählungen lernen wir Hofnarren, Henker, Zwangsarbeiter, Bettler und Dissidenten kennen - und die anrührende Marfuscha, die wie Tausende anderer Kinder am Weihnachtstag auf dem Roten Platz ein Kremlmodell mit Mauern, Türmen und Toren ganz aus Zucker geschenkt bekommt. Weil alle Brennstoffe ins Ausland verkauft werden, heizen auch wohlsituierte Moskauer mit Holzscheiten, und die Aufzüge der Wohnhäuser stehen am Wochenende still. Der Alltag ist geprägt von Angst und Gewalt, versüßt wird erhöchstens aus der Zuckerdose oder eben mit den fabrikmäßig hergestellten Zuckerkremln, die mal als Devotionalie, mal als Ersatzbefriedigung fürs Volk dienen: ein Trost, den man lutschen kann. Wie auch Sorokins anti-utopischer Roman »Der Tag des Opritschniks« besticht »Der Zuckerkreml« durch große sprachliche Kraft, stilistischen Reichtum und die literarische Könnerschaft des Autors, der uns eine Welt vorführt, in der die ärgsten Albträume, die zu träumen das Russland von heute Anlass gibt, Wirklichkeit geworden sind.
Russland im Jahr 2028: ein neues Mittelalter, geprägt von Informations- technologie und Massenarmut. Körperliche Züchtigung ist an der Tagesordnung. In einem gewaltigen Stimmenchor führt Sorokin den Leser durch die dunklen Seitengassen des Lebens in einem utopischen Russland, das er dem heutigen wie einen Zerrspiegel vorhält.
In fünfzehn virtuosen Kurzerzählungen lernen wir Hofnarren, Henker, Zwangsarbeiter, Bettler und Dissidenten kennen - und die anrührende Marfuscha, die wie Tausende anderer Kinder am Weihnachtstag auf dem Roten Platz ein Kremlmodell mit Mauern, Türmen und Toren ganz aus Zucker geschenkt bekommt. Weil alle Brennstoffe ins Ausland verkauft werden, heizen auch wohlsituierte Moskauer mit Holzscheiten, und die Aufzüge der Wohnhäuser stehen am Wochenende still. Der Alltag ist geprägt von Angst und Gewalt, versüßt wird erhöchstens aus der Zuckerdose oder eben mit den fabrikmäßig hergestellten Zuckerkremln, die mal als Devotionalie, mal als Ersatzbefriedigung fürs Volk dienen: ein Trost, den man lutschen kann. Wie auch Sorokins anti-utopischer Roman »Der Tag des Opritschniks« besticht »Der Zuckerkreml« durch große sprachliche Kraft, stilistischen Reichtum und die literarische Könnerschaft des Autors, der uns eine Welt vorführt, in der die ärgsten Albträume, die zu träumen das Russland von heute Anlass gibt, Wirklichkeit geworden sind.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit dem Erzählungsband "Zuckerkreml" sieht die begeisterte Nicole Henneberg Vladimir Sorokin politisch und literarisch voll auf der Höhe. Der russische Autor, der mühelos durch Stilarten und Genres wandert, wie die Rezensentin betont, entwirft hier ein Russland im Jahr 2028, in dem das Volk mit Zucker und religiösem Rigorismus gefügig gemacht worden ist. Züchtigungen und Hinrichtungen sind an der Tagesordnung und bannen die Menschen mit Angst, aber auch mit Faszination, so die Rezensentin beeindruckt. Für Henneberg ist das jüngste Buch des für seinen letzten Roman von der "ultranationalistischen Kreml-Jugend" wegen Pornografie angezeigten russischen Autors ein beängstigendes, "sarkastisches" und beeindruckendes Gesellschaftsbild. Nicht nur für dieses Buch feiert sie Sorokin als Glücksfall für die Literatur, der immer dann am besten schreibe, wenn er "empört" sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Entweder man hat Angst oder man schreibt. Vladimir Sorokin hat sich fürs Schreiben entschieden und wagt mit seinem neuen Erzählungsband "Zuckerkreml" einen düster-satirischen Blick ins Jahr 2028: Russland erliegt dem dumpfen Kollektivrausch.
Vladimir Sorokin ist nicht ein Schriftsteller, sondern viele: Unzählige Stile und Gattungen hat er ausprobiert, hat Idyllen und Mafiageschichten geschrieben, Allegorien auf die russische Mangelwirtschaft und Dekonstruktionen von Familienepen nach Turgenjewschem Muster. Man merkt seinem Schreiben die strenge, klassische Schule an und spürt an jedem zweiten Satz, dass er den russischen Romanfundus des neunzehnten Jahrhunderts durchgekaut und verdaut hat. Allerdings hat er ihn um die genaue Beobachtung der Gesellschaft angereichert und in sexuellen Dingen kein Blatt vor den Mund genommen, genauso wenig bei der Beschreibung von Gewalt - denn er war sich immer bewusst, dass er in einem der gewalttätigsten Länder dieser Welt lebt.
Er selbst behauptete im Jahrzehnt vor und nach der Wende, ein "apolitischer" Schriftsteller zu sein, was in seinem Fall vor allem hieß, dass er zu Sowjetzeiten nicht als Dissident verstanden werden wollte - er wäre sonst in ein sehr genau bezeichnetes, moralisches Korsett geschnürt gewesen. Und nach der Wende, als übergroße Hoffnungen im Land keimten, unternahm er, als dessen hochsensibler Seismograph, mit seiner "Ljod"-Trilogie einen entspannten Ausflug in die Fantasy-Welt. Auf tausend Seiten gab er sich dem Traum hin, durch die Augen seiner Figuren die Verführungskräfte und Zerstörungspotentiale der großen Utopien erkennen und kategorisieren zu können - was dieses Riesenprojekt teils überambitioniert, teils kitschig-banal wirken lässt.
Mit seinem neuen Erzählungsband "Der Zuckerkreml", der dort einsetzt, wo der beklemmende, allegorische Roman "Der Tag des Opritschniks" (2008) endet, ist Sorokin auf die politische Bühne zurückgekehrt, und zwar entschlossener und radikaler als zuvor. Er weiß, dass er damit im heutigen Russland gefährlich lebt, aber er sagt lakonisch: "Ich habe mich schon vor langer Zeit entschieden, dass man sich entweder fürchten kann - oder man schreibt." Die Gesellschaft, die er in seinen neuen Geschichten entwirft, ist nicht nur grausam, sondern steuert auf furchterregend direktem Kurs in die Barbarei.
Die Opritschniki, eine Wiederauferstehung der Schreckensgarde Iwans des Schrecklichen, beherrschen im Jahr 2028 das Land. Sie brandschatzen und morden mit kindlich-sadistischer Freude und sind dabei, Russland in ein Entwicklungsland zu verwandeln. Bürgerliche Tugenden oder Berufe existieren kaum noch, in den Hochhäusern wird mit Holz geheizt, und nachbarschaftliche Beziehungen pflegt man nur noch zu China. Nach dessen Vorbild bauen Strafbataillone die Große Russische Mauer, und jedes Schulkind muss wissen, wie viele Steine darin noch fehlen. Ein grausamer Scherz am Rande: Die Bewohner haben, dem Wunsch ihres Gossudaren (Großfürsten) folgend, ihre Reisepässe verbrannt, dafür schwebt sein schmales (Putin nicht unähnliches) Gesicht als 3-D-Ikone in jedem Wohnzimmer. Doch die Menschen scheinen zufrieden, sogar glücklich mit dieser Entwicklung zu sein, was nicht nur an der neuen Droge Zucker liegt, sondern an einer rigorosen Gläubigkeit, über deren eiserne Regeln Scharfrichter wachen.
In der Kneipe "Glückliches Moskowien" sitzen sie zusammen und philosophieren. "Matwej ist der Älteste und Erfahrenste von ihnen. Er züchtigt schon das neunte Jahr; an die achtzigtausend Ärsche will er unter der Knute gehabt haben. Ein stattlicher Mann, dieser Matwej: breitschultrig, mit Rauschebart. Und hat er seine zwei Mariechen intus, trägt er gut und gern ein bisschen dicker auf." In größter Eintracht treffen sich an diesem heimeligen Ort schwarze Söldner, chinesische Händler, Zinseintreiber, Studenten, Bettler, Akrobaten, Krämerinnen, Prostituierte und einfache Trinker - ein sozialer Querschnitt in Anlehnung an die sowjetische Tradition, nur haben sich die Themen grundlegend geändert: Es geht ums Pfählen und Enthaupten, um verbotene Sexualpraktiken und Prügelstrafen. Und nicht nur in der Kneipe, auch beim Schlangestehen sind das die brennenden Fragen.
In Sorokins Roman "Die Schlange" von 1985 ging es um enge Gemeinschaftswohnungen, die Beatles, Alkoholnachschub und unterhaltsame Massenprügeleien. Jetzt denken die Menschen über die Wohltat der rituellen Züchtigung nach. Eine junge Schönheit prahlt: "Er schlägt mich, das heißt doch, er liebt mich! Außerdem ist er ja keiner von denen, die besoffen drauflosprügeln. Er züchtigt mit der Rute - ganz wie es das alte russische Brauchtum vorschreibt. Meine liebe alte Mutter beneidet mich darob: In den wirren Zeiten ihrer Jugend war es untersagt, sein Weib zu züchtigen, denn damals war Russland von Gott verlassen. Hätte dein seliger Vater mich damals allsamstäglich ausgepeitscht, lebten wir heute in einem Haus mit drei Etagen, spricht sie."
Die ultranationalistische Kreml-Jugend jedenfalls dürfte keinen Grund sehen, Sorokin wie 2002 wegen "Pornographie" anzuzeigen oder sein neues Buch öffentlich in einem riesigen Pappmaché-Klo zu versenken, denn so listig sanft und klassisch hat er schon lange nicht mehr erzählt. Vielleicht seit "Norma" nicht, den frühen subversiven Erzählungen um eine geheimnisvolle, braune Speise, die höchsten Genuss und schnelle Abhängigkeit erzeugt und in Fabriken, im ZK-Büro, aber auch in Dissidenten- und Künstlerkreisen begehrt ist - und sich nach und nach als Kot entpuppt. "Die Kommunisten kommen wieder an die Macht, und wahrscheinlich gibt es in einigen Jahren wieder Norma, dann mit Coke", prophezeite Sorokin im Jahr 2003, als "Norma" auf Deutsch erschien.
Dass jetzt Zucker daraus geworden ist, hat mit der Verschiebung von harten zu weichen Drogen zu tun, denn Norma war nur mit viel Wodka genießbar, während die allgegenwärtige Überzuckerung eine Dauereuphorie erzeugt. Alle erliegen ihr: Kinder und Intellektuelle, Obdachlose und Folteroffiziere. Besonders die Henker lieben die Süßigkeit.
Sorokins Verstörung über den kultischen Erfolg seines als Abwehrzauber gedachten Romans "Der Tag des Opritschniks" - den die Realität zum Teil bereits eingeholt hat - wurde nicht nur der Auslöser für die neuen Erzählungen, sondern hat in ihnen auch tiefe Spuren hinterlassen. Sein Blick auf die Gesellschaft ist so gnadenlos und sarkastisch wie nie zuvor: Die Menschen hängen ängstlich und sentimental an den Lippen von selbsternannten Heiligen, sind unterwürfig, machtgierig und bequem. Nur die niedrigsten Instinkte funktionieren noch. In einer der schönsten Geschichten flucht, greint und säuft der Zwerg Petruschka vor dem 3-D-Bild des Gossudaren. Sein Hausroboter sekundiert ihm, liefert die Stichworte und tröstet, denn Petruschkas Spaßmachertruppe ist wegen ihrer Frechheiten im Kreml in Ungnade gefallen.
Und während der Zwerg immer betrunkener wird, versucht er zu tanzen, singt, reißt Witze und jammert im gleichen Atemzug seiner verbannten Geliebten hinterher. Ein groteskes, von Andreas Tretner schwungvoll übersetztes Stakkato, das etwas tröstlich Widerständiges hat, weil der Hilflose sich als der Eigensinnigste erweist, während sich die erklärten Regimegegner nachhaltig von der Macht korrumpieren lassen und ihre konspirativen Treffen für psychedelische Trips nutzen, auf denen sie, in Wolfshunde verwandelt, die Herrscherfamilie zerfleischen. Danach fühlt sich ihre Seele "ruhig und leicht". Ein böseres Fazit ist kaum denkbar, auch wenn der Autor sich jede seiner Figuren mit der gleichen Hingabe und zärtlichen Emphase vornimmt. Die ständig wechselnde Identifikation sei seine Droge, bekannte er in einem Interview, und es ist ein Glück für die Literatur, dass er dieser Leidenschaft gefolgt und zu den realen Dämonen der russischen Gesellschaft zurückgekehrt ist: Wenn Sorokin empört ist, schreibt er am besten.
NICOLE HENNEBERG
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Seine Prosa lebt von der sprachlichen Wucht und vom zornigen Einfallsreichtum, mit dem ein Autor hier gegen die Borniertheit anschreibt.« Christoph Schröder spiegel.de