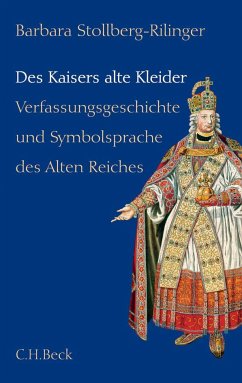Barbara Stollberg-Rilinger erhält den Preis des Historischen Kollegs 2013
Eine der besten Kennerinnen der Geschichte des Alten Reiches erhellt das faszinierende Wechselspiel von schriftlich fixierter Verfassung und im Ritual gelebter Verfassungswirklichkeit. Zum ersten Mal wird Verfassungsgeschichte konsequent von den symbolisch-rituellen Formen und ihrem Wandel her verständlich.
Wie wurden Vasallen des Reiches belehnt? Wie verständigte man sich auf den Reichstagen? Wie verkehrten die Gesandten an den Höfen der Fürsten? Was über diese Fragen in der Verfassung bestimmt war, war die eine Sache, doch ob und in wieweit diese Regeln mit Leben erfüllt wurden, war eine andere - war abhängig von sehr komplexem symbolisch-rituellen Handeln. Barbara Stollberg-Rilinger zeigt in ihrem spannenden Buch, wie eine politische Formensprache, die alle Beteiligten beherrschten - gleichsam eine Art symbolischer Grundwortschatz - unverzichtbar war, um sich über die gemeinsame Ordnung zu verständigen.
Eine der besten Kennerinnen der Geschichte des Alten Reiches erhellt das faszinierende Wechselspiel von schriftlich fixierter Verfassung und im Ritual gelebter Verfassungswirklichkeit. Zum ersten Mal wird Verfassungsgeschichte konsequent von den symbolisch-rituellen Formen und ihrem Wandel her verständlich.
Wie wurden Vasallen des Reiches belehnt? Wie verständigte man sich auf den Reichstagen? Wie verkehrten die Gesandten an den Höfen der Fürsten? Was über diese Fragen in der Verfassung bestimmt war, war die eine Sache, doch ob und in wieweit diese Regeln mit Leben erfüllt wurden, war eine andere - war abhängig von sehr komplexem symbolisch-rituellen Handeln. Barbara Stollberg-Rilinger zeigt in ihrem spannenden Buch, wie eine politische Formensprache, die alle Beteiligten beherrschten - gleichsam eine Art symbolischer Grundwortschatz - unverzichtbar war, um sich über die gemeinsame Ordnung zu verständigen.

Der Code des Gemeinwesens: Barbara Stollberg-Rilinger schreibt eine Geschichte der politischen Formenlehre
Das Buch der Münsteraner Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger hat einen erstaunlich lockeren Titel, der es aber nicht hindern wird, schnell zu einem Standardwerk der modernen Verfassungsgeschichte zu werden. Er lässt den Leser hintersinnig das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern assoziieren: In Andersens Spottstunde steht der Kaiser am Ende ohne Ansehen dar, weil er auf Betrüger hereingefallen ist; sie versprachen dem Herrscher Einsicht durch die Probe der Sinnlichkeit. Erst die Stimme eines unschuldigen Kindes spricht die nackte Wahrheit aus.
Andersens Märchen verweist auf einen Verblendungszusammenhang, in dem die Einsicht vom Ansehen entkoppelt ist. Es wird der Vormoderne zugeschrieben und ist antihöfisch und antimonarchisch gedacht. Man kann es somit als antizeremonielles Stück lesen, und es wäre eine typische Sicht des neunzehnten Jahrhunderts auf jene Sinnlichkeit, die die Vormoderne zuhauf produzierte. Standen dort Strategien der Sichtbarkeit hoch im Kurs, so schüttete die bürgerliche moderne Kritik Unverständnis und Spott darüber aus. Von Symbolen, Ritualen und Zeremonien hielt sie nicht viel, und die ältere Verfassungsgeschichte duplizierte dieses Unverständnis.
Die Kleider des Kaisers
Das hat die moderne, interdisziplinär arbeitende Forschung sattsam überwunden, und Stollberg-Rilinger gehört in die erste Reihe jener, die die Festung sturmreif geschossen haben. Auf diesen Trümmern errichtet sie nun ein neues Gebäude, das die bleibenden Verdienste der älteren, juristisch-normativ geprägten Verfassungsgeschichte zusammenführt mit Einsichten der Kultursoziologie. Das hat sie jahrelang mit bedeutenden Aufsätzen vorbereitet, die aus dem Münsteraner Sonderforschungsbereich "Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme" hervorgegangen sind. Ihre reife Frucht ist dieses eindrucksvolle Buch, dessen Klarheit, Präzision und Originalität keinen Zweifel daran lassen, dass dieser große Wurf das Fach endgültig ins 21. Jahrhundert katapultiert.
Stollberg-Rilingers programmatischer Titel meint freilich etwa anderes als eine Geißelung zeremonieller Verblendungszusammenhänge im Sinne Andersens. Der gemeinsame Nenner endet bei den reichen Fiktionen, deren die Politik der Vormoderne zweifellos bedurfte und auf die sie sich sinnlich stützte. Traditionen wie die angeblich alten Kleider des Kaisers wurden allenthalben mobilisiert und inszeniert. Ihre Verfassungsgeschichte wiederholt jedoch den Andersenschen Vorwurf der Lüge oder Täuschung an die Akteure; wo Stollberg-Rilinger die gemeinsam geglaubten Fiktionen in ihrer Wirkungsweise soziologisch und verfassungsrechtlich analysiert, geht es ihr um öffentliches Auftreten und seine performative Wirkung.
Diese Idee wird in vorbildlich transparenter Weise in Einleitung und Epilog des Buches entfaltet. Sie besagt, dass die Verfassung des Alten Reiches in der Teilnahme an seinen öffentlichen, symbolisch-rituellen Akten, den Solennitäten, gründete. Dabei sein war alles, denn wer dabei war, signalisierte Zustimmung, er bekräftigte, dass er sich auch künftig an die normative Ordnung halten würde: "Anwesenheit bedeutete Akzeptanz" - alle Gefahren inbegriffen.
Umgekehrt musste daher, wer nicht oder nur bedingt zustimmen wollte, seinen Protest durch glattes Fernbleiben oder abgemilderte kommunikative Strategien demonstrativ zum Ausdruck bringen. Das verlieh Zeremoniell, Symbolen, Ritualen, Gesten und Verfahren eine konstitutive Bedeutung und verkomplizierte sie zugleich ungeheuer. Hier tradierte sich ein gutes Stück Mittelalter: Es herrschte eine politische Kultur der Präsenz, die der Schriftlichkeit nur einen verminderten Rang zuwies. "Verfassung" war nicht das, was abstrakt in einem gedruckten, veröffentlichten Text stand und von einem Gesetzgeber erlassen wurde (so aber unser Verständnis seit 1789), sondern ein Geflecht aus personalen Beziehungen, das immer wieder aufs Neue bekräftigt werden musste.
Dieser kollektive Glaube hielt die Formen ebenso für unverfügbar, wie er sie gleichzeitig kritisierte und zu modifizieren suchte. Diese durchaus paradox zu nennende Symbolfixierung hielt das System gewissermaßen am Leben. Die politischen Akteure - Kaiser, Stände, Gesandte - beschäftigten sich unablässig mit äußerlichen Details, weil diese der eigentliche Code des Gemeinwesens waren, und sie brachten einen spezifischen Rechtsbegriff hervor. Seine Normativität müsste freilich noch genauer untersucht werden. Was ihnen aus heutiger Sicht scheinbar an Exaktheit in den staatstheoretischen Begriffen fehlte, das fanden sie in den konkreten Formen. Weil wir zu lange das eine nicht verstanden haben, so Stollberg-Rilinger, kritisierten wir das Fehlen des anderen umso schärfer. Beides missachtete das genuin Vormoderne dieses Systems.
Logik der Zugehörigkeit
Stollberg-Rilinger dekliniert im Hauptteil diese politische Formenlehre anhand der verfassungsgeschichtlich maßgeblichen Stationen des Alten Reiches durch: 1495, 1530, 1653/54, 1764/65. Die Zäsuren sind tradiert, neu sind die soziologischen Deutungsmuster, die auf Logiken der Zugehörigkeit und die Macht der Zeichen abstellen statt primär auf normative Texte. Eines der symptomatischen Kennzeichen war die jahrhundertelange parallele Existenz von faktischer Praxis mit einer Vielzahl konkurrierender Ansprüche. Ein Schlussstein fehlt in diesem komplizierten Bau. Als 1806 das Ende kam, wurde es anders als bei den anderen Wegmarken nicht versinnbildlicht; symbolisch-rituelle Repräsentationen des Endes aller vormodernen Repräsentationskultur fehlen.
Trotz aller Verschiebungen, die im Verlauf dieser 300 Jahre stattfanden, gibt es doch konstitutive Gemeinsamkeiten der politisch-juristischen Kultur. Wenn man eine grobe Schätzung abgeben müsste, dürfte man vermuten, dass diese Gemeinsamkeiten die Unterschiede deutlich überwiegen. Dennoch betont Stollberg-Rilinger unablässig die vielfachen Umbrüche, denen ihr Altes Reich unterliegt: Reichsreform, Glaubensspaltung, Europäisierung der Friedensordnung des Reiches sowie Antitraditionalisten und Antiritualisten auf den Thronen trieben Wandel und Zerfall der symbolischen Praxis voran.
Diese Akzente sind wichtig und richtig, denn ohne die sich zunächst leise andeutenden Verschiebungen verstünde man am Ende das unverhohlene Befremden der letzten Reichspublizisten nicht. Johann Jakob Moser kritisiert die "schwere Menge weitläufftiger, mir selbst eckelhaffter und auswärtigen Nationen billig unbegreifflich scheinender Ceremoniel-Streit- und Kleinigkeiten". Der mehrfach und immer sehr passend zitierte junge Hegel notiert 1802 "Aberglauben an die ganz äußeren Formen" - distanzierte Abgesänge der Zeitgenossen auf eine Kultur, die sich überlebt hatte. Sie werden später nahtlos übergehen in die wissenschaftliche Missachtung jener symbolischen Formen, die diesen durch die Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts zuteil wird.
Zugleich wirft aber diese Erzählung die Frage nach der Grenze der Spezifika auf, und sie ist eine doppelte. Erstens fragt man sich nach alledem, inwieweit die Dichotomie von Vormoderne und Moderne getrieben werden darf. Wie sehr hat unser Politikstil der Moderne mit jener personalisierenden Kultur gebrochen? Ihm schreibt die Autorin in weberianischem Klassizismus "Sachlichkeit, Nüchternheit, Schriftlichkeit und Professionalität" zu. Indes könnten moderne Politiker wie Projektmanager vormodernen Zeremonialbüchern beipflichten, welcher gesteigerte Verpflichtungsgrad durch Anwesenheit erreicht wird - und was im Konfliktfall das Gegenteil bedeutet. Anders gesagt: Wir sind vielleicht niemals so modern gewesen, wie wir mal geglaubt haben.
Von der Vormoderne zum Alten Reich weitergedacht, stellt sich zweitens die Frage nach der Vergleichbarkeit dieser Strukturen im internationalen Kontext. Die deutschen Verhältnisse begünstigten solchen eigenwilligen Umgang mit politischen Konflikten: Viele Herrschaftsträger, schwache Zentralgewalt, Neigung zur Visualisierung bei intensiver Gelehrsamkeit der Berater führten zu rangrechtlichen Obsessionen, über die die europäischen Nachbarn spotteten. Doch wurde auch an Universitäten anderer Länder über das Recht, mit sechs Pferden zu fahren, disputiert oder über rot- versus schwarzsamtene Sessel, und wenn ja, mit welchen Abweichungen? Schließlich: Was könnte der momentane Wandel der Staatlichkeit mit der Wahrnehmungsverschiebung in der Verfassungsgeschichte zu tun haben? Stollberg-Rilinger bietet der Verfassungsgeschichte nicht nur Perspektiven, sondern hat die Arena für weitere Kontroversen geöffnet.
MILOS VEC
Barbara Stollberg-Rilinger: "Des Kaisers alte Kleider". Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches. Verlag C. H. Beck, München 2008. 439 S., 17 Abb., geb., 38,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Mit großem Interesse hat Eberhard Straub Barbara Stollberg-Rilingers Buch über die Verfassungsgeschichte des Alten Reiches und wie diese in Symbolen, Bildern und Ritualen repräsentiert wurde, gelesen. Die von den Aufklärern als "Mummenschanz" verachtete Repräsentationskunst der Kaiser, des Reichstags oder der Fürstenhöfe zeigt die Autorin in ihrer Kraft als "Ausdrucksmacht" einer nicht selten verwirrenden und paradoxen Ordnung, betont der Rezensent gefesselt. Er findet, dass es der Autorin sehr gut gelingt, diese Vergegenwärtigungen eines komplexen Reichsgebildes plastisch hervortreten zu lassen und irgendwie entdeckt Straub in ihrer eingehenden Untersuchung der Symbolsprache des Alten Reiches auch eine "Poesie", die den "Dingen Dauer" verleiht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH