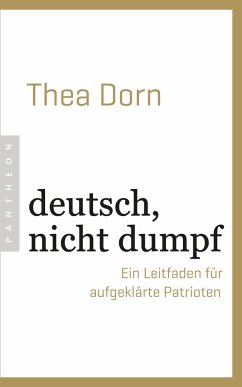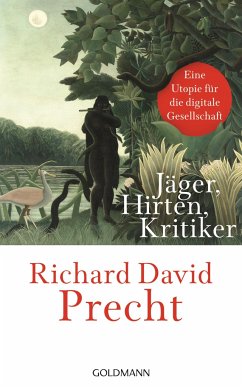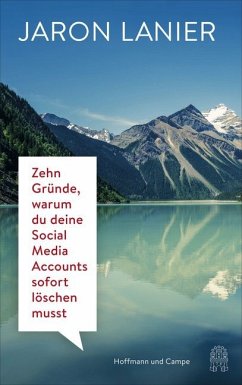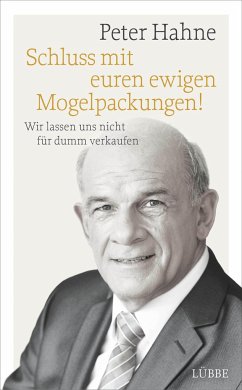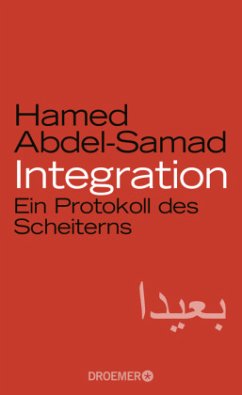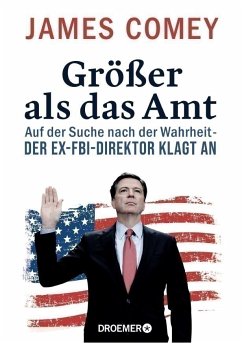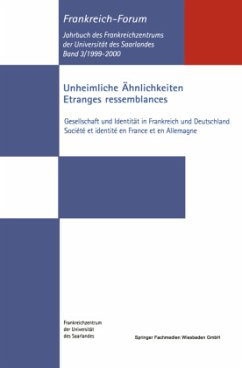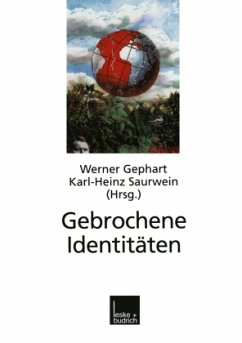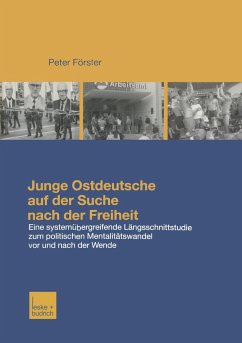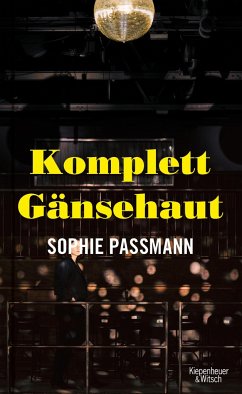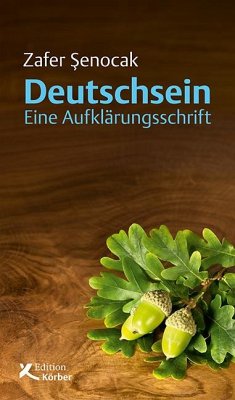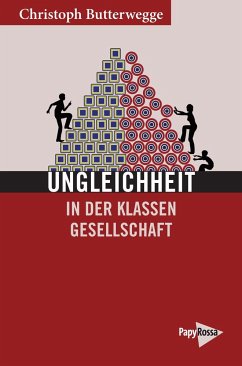Nicht lieferbar
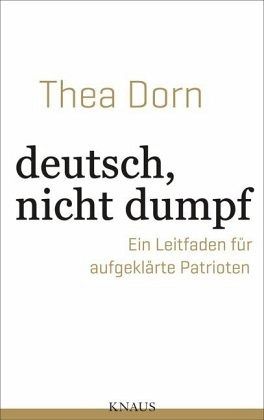
Deutsch, nicht dumpf
Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Heimat, Leitkultur, Nation: Thea Dorn will diese kontroversen Themen nicht den Rechten überlassenSeit Jahren streiten wir, und der Ton wird rauer: Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus und Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu...
Heimat, Leitkultur, Nation: Thea Dorn will diese kontroversen Themen nicht den Rechten überlassen
Seit Jahren streiten wir, und der Ton wird rauer: Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus und Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu der das heutige Deutschland ja inzwischen längst gefunden hat? Anknüpfend an Themen, die sie bereits in ihrem Bestseller "Die deutsche Seele" (zusammen mit Richard Wagner) erkundet hat, wendet Thea Dorn sich nun den aktuellen Schicksalsfragen unserer Gesellschaft zu - differenziert, unaufgeregt und dennoch leidenschaftlich.
Seit Jahren streiten wir, und der Ton wird rauer: Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus und Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu der das heutige Deutschland ja inzwischen längst gefunden hat? Anknüpfend an Themen, die sie bereits in ihrem Bestseller "Die deutsche Seele" (zusammen mit Richard Wagner) erkundet hat, wendet Thea Dorn sich nun den aktuellen Schicksalsfragen unserer Gesellschaft zu - differenziert, unaufgeregt und dennoch leidenschaftlich.