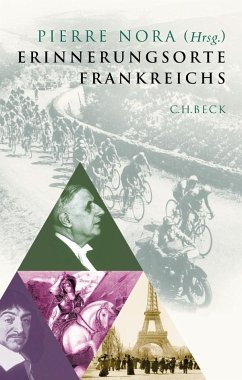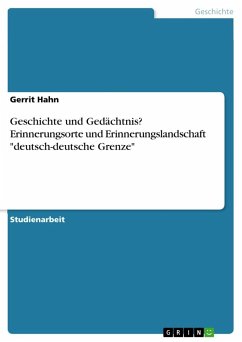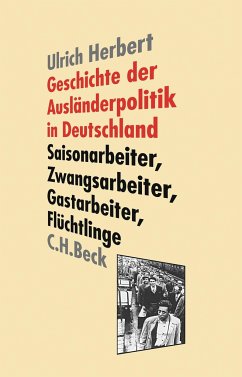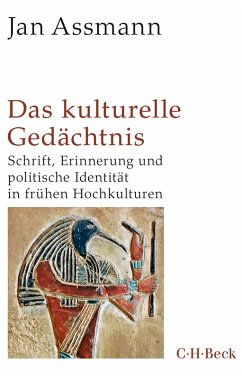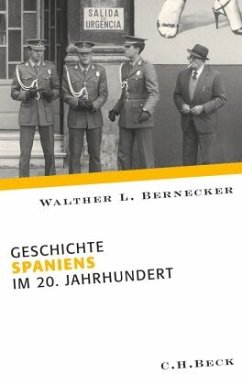"Das Vorbild für das gewaltige, mit der Veröffentlichung des zweiten und des dritten Bandes nun abgeschlossenen Unternehmens, liegt auf der Hand: Pierre Noras 1984 erschienene "Lieux de Memoire". Nora verbindet darin das von Halbwachs geborgte Konzept des "kulturellen Gedächtnisses" mit einer, von Friedrich Wilhelm Graf hier "zweifelhaft" genannten, kulturkritischen Perspektive. Das Grundkonzept der deutschen Antwort ist ein anderes. Das hat einerseits mit dem, aus gutem Grund, viel gebrocheneren Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte, damit auch zur ihren Erinnerungsorten, zu tun. Zum anderen aber halten es die Herausgeber, nach Ansicht Grafs jedenfalls, fröhlich mit der Postmoderne. Die Auswahl steht zu
ihrer partiellen Willkürlichkeit und der Rezensent stellt dennoch die Fragen, die darob doch ein wenig müßig scheinen: "Warum aber soll man der Bundesliga gedenken, nicht aber der Nationalmannschaft?" Ein gewisses Unwohlsein spricht auch aus seiner Bemerkung, man habe selbst für dieses Werk "Gastarbeiter" (soll heißen: nicht-deutsche Autoren) eingeladen. Der Begriff, den sich die Herausgeber vom "Ort" machen, passt ihm gleichfalls nicht recht ins Konzept: man versteht ihn als "Topos" und somit als unfixiert, mal materiell, dann aber auch nicht. Zum Schluss wird Graf ganz ungeduldig und ungehalten: es wird vom Buch doch tatsächlich kein Sinnzusammenhang hergestellt, keine normative Orientierung geboten. Das, so das Rezensenten-Verdikt, ist "Geschichtsreligion light", da hilft die ganze "faszinierende Materialfülle" nichts.
© Perlentaucher Medien GmbH"