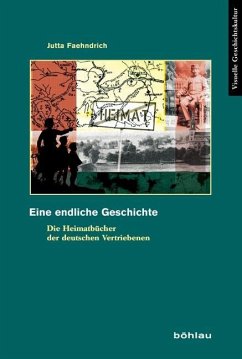Deutsche und polnische Vertriebene
Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956. Diss.
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
65,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg war ein europäisches Phänomen, von dem keineswegs nur Deutsche betroffen waren, sondern - neben anderen - auch Polen. Nach Kriegsende behielt die Sowjetunion einen Großteil der annektierten polnischen Ostgebiete; dafür erhielt Polen die ehemaligen deutschen Ostgebiete. Als Folge dieses international gesteuerten Prozesses mußten Millionen Polen und Deutsche ihre Heimat verlassen. Philipp Ther behandelt die Vertriebenenproblematik im Vergleich zwischen Polen und der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)/DDR; auch Westdeutschland wird in die Betrachtung...
Die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg war ein europäisches Phänomen, von dem keineswegs nur Deutsche betroffen waren, sondern - neben anderen - auch Polen. Nach Kriegsende behielt die Sowjetunion einen Großteil der annektierten polnischen Ostgebiete; dafür erhielt Polen die ehemaligen deutschen Ostgebiete. Als Folge dieses international gesteuerten Prozesses mußten Millionen Polen und Deutsche ihre Heimat verlassen. Philipp Ther behandelt die Vertriebenenproblematik im Vergleich zwischen Polen und der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)/DDR; auch Westdeutschland wird in die Betrachtung mit einbezogen.Wie kam es zu den massenhaften, gewaltsamen Bevölkerungsverschiebungen? Warum scheiterte die geplante "ordnungsgemäße und humane Durchführung" der Vertreibung? Wie wurden die Vertriebenen aufgenommen? Während in Polen die Vertriebenen unter dem Dach des polnischen Nationalismus integriert werden sollten, betrieb die SBZ/DDR eine egalitäre Politik: Durch Umverteilungen sollten die Vertriebenen in die Gesellschaft eingebunden werden. Nach dem Scheitern dieser Ansätze griffen beide Regime Ende der vierziger Jahre zunehmend zu polizeistaatlichen Maßnahmen. Die Vertriebenenproblematik wurde nun eher unterdrückt als gelöst. Eine negative, von Konflikten geprägte Einstellung anderer Bevölkerungsgruppen zu den Vertriebenen hatte die integrative Politik unterlaufen.Die Anwesenheit von Millionen Vertriebenen hatte einen prägenden Einfluß auf die Nachkriegszeit in der SBZ/DDR und in Polen. Diese Studie geht daher über eine reine Vertriebenengeschichte hinaus: Sie trägt wesentlich zum allgemeinen Verständnis der Staaten und Gesellschaften Mittel- und Osteuropas bei.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.