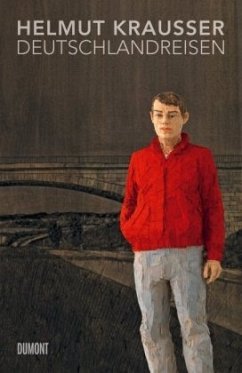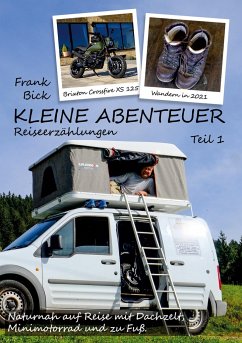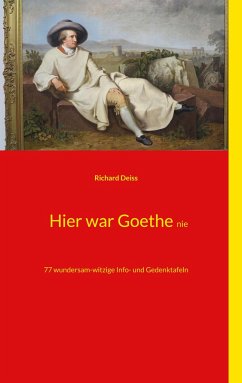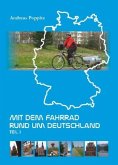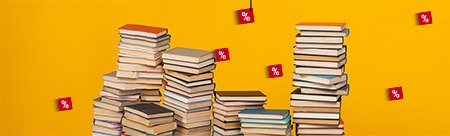Vier Jahreszeiten und vier Himmelsrichtungen gibt es. Vier Reisen hat Helmut Krausser unternommen. In alle Winkel Deutschlands ist er gereist. Mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Taxi und zu Fuß. Helmut Krausser charakterisiert Städte aufmerksamer und sensibler als andere Autoren ihre Romanfiguren. Er ist ein scharfsinniger Beobachter unserer Gegenwart, knallhart zu sich selbst und zu allen, die ihm über den Weg laufen. Ergänzt um die Poetikvorlesungen 'Pathos und Präzision', die der Autor an der LMU München hielt, werden die Reiseberichte und Tagebuchaufzeichnungen so zum intimsten Einblick in sein Werk.»Es ist seltsam, in ein Alter gekommen zu sein, da man die meisten Städte, die man bereist, mit Siegen oder Niederlagen in Verbindung bringen kann. Die Landkarte wird historisch, wird zum Schlachtfeld.«
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Daniela Strigl ist entsetzt. Dass der eigentlich von ihr bewunderte Autor derart wenig Selbstironie oder Geist und Witz, dafür umso mehr Eitelkeit und Testosteron an den Tag legen könnte, hätte sie nicht gedacht. Was Helmut Krausser hier abliefert, Reisetagebuchausschnitte an Poetikvorlesungen, macht Strigl verlegen. Auch wenn zwischen Notaten über Hotelniveaus, Lesungshonorare und Zuhörerzahl immer mal wieder Kraussers dramatisches Talent aufblitzt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Schleich di: Helmut Krausser geht selbstverliebt auf Reisen und bewirbt sich für den "Ring" in Bayreuth
Dies ist ein Verlegenheitsbuch. Ein Buch von der Sorte, die ein Verlag mit seinem Autor auf den Markt wirft, um wieder einmal ein Lebenszeichen zu geben. So produktiv Helmut Krausser ist: Sein letzter Roman "Nicht ganz schlechte Menschen" erschien 2012.
"Deutschlandreisen" vereinigt vier nach Jahreszeiten geordnete Abschnitte aus Kraussers Reisetagebüchern und, jeweils dazwischen, seine Poetikvorlesungen an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, sieht man von Kraussers Autorschaft ab und dem Umstand, dass München, "diese überzuckerte Stadt", für jemanden, der in Berlin wohnt, ein Reiseziel darstellt.
Dies ist aber auch deshalb ein Verlegenheitsbuch, weil das Ich, das sich darin ausbreitet und entblößt, seine Leser verlegen macht; indem es Sätze wie diesen von sich gibt: "Ein Künstler zu sein und Erfolg über Jahrzehnte zu haben ist ein beneidenswerter und jedem zu empfehlender Umstand, mit dem sich auch das Alter würdevoll bewältigen läßt." Oder, mit einem stilistischen Stolperer: "Ich bin in fast jedes europäische Land übersetzt worden, nur in kein skandinavisches. Mit nicht einem Buch. Unfaßbar an sich." Gern würde man dem Autor wenigstens ein Fünkchen Selbstironie attestieren, doch er besteht ernstlich darauf: "Selbstbewunderung ist eine feine Sache."
So reist dieses Ich, das Helmut Krausser heißt, von Stadt zu Stadt und sieht alles bloß als Kulisse und Spiegelbild, von Eisenach ("Hier wurde nie etwas von mir aufgeführt, und es regnet") bis Mannheim, wo der Autor einst mit seiner Band spielte und nun zur Erkenntnis gelangt, es sei "seltsam, in ein Alter gekommen zu sein, da man die meisten Städte, die man bereist, mit Siegen oder Niederlagen in Verbindung bringen kann". Nicht nur seltsam, sondern bedenklich ist es, wenn man augenscheinlich nichts anderes tut.
Krausser beschreibt Lesereisen als, vom eigentlichen Vorlesen abgesehen, überaus enervierende Unternehmungen. Notierenswert erscheinen ihm das jeweilige Hotelniveau, die Zuhörerzahl, die Manieren der Veranstalter und die Entlohnung: "Immerhin, die Kohle stimmt." Leipzig reizt ihn vor allem als Schauplatz seines Romans "Eros" - "ich gehe sofort zur Connewitzer Buchhandlung, um mich am Anblick der elf verschiedenen Titel von mir zu erigieren, die da im Regal stehen. Wir Schriftsteller sind schon ein albern eitles Volk." Auf rätselhafte Weise gelingt es Krausser, auch noch Selbstkritik als eine Spielart der Eitelkeit zu betreiben.
Seine Prosa-Schnitzel liest dieser Reisende recht wahllos vom Wegesrand auf: "Alles ist ja für irgendwas gut. Wenn man darüber schreiben kann, ist es gut. Viele können das nicht. Welch angestautes Leben müssen jene führen?" Hier hingegen kann einer sein Wasser nicht halten und verwandelt jedes Ärgernis in ein Notat. Zum Beispiel seine Unbill mit dem Management des Kölner Hilton oder seinen Zusammenstoß mit einem Münchner Kriminalen in Zivil, der dem kritischen Beobachter einer fragwürdigen Amtshandlung einen nicht minder fragwürdigen Platzverweis erteilt, und zwar mit den demütigenden Worten: "Schleich di." Auch in anderen Szenen blitzt Kraussers Kunst der dramatischen Konfrontation auf, etwa wenn er mit Zollbeamten über die Klassifikation eines Puccini-Briefes verhandeln muss oder ein wütender weinender Perser ihn in einem Internetcafé verprügeln will.
Krausser erklärt sich als Komponist und bewirbt sich recht explizit als Regisseur für den "Ring" in Bayreuth, er wirbt für seine Idole, den großen Puccini und den immer noch unbekannten Alberto Franchetti, er "verbessert" dreist Brechts "Erinnerung an Marie A." und Rilkes "Panther", würdigt einleuchtend die Verdienste Ernst Jüngers und kommt zu der erfrischenden Einsicht, "daß Mädchen vielleicht gnadenlos unterschätzt werden. Gäbe es kein Testosteron, Mädchen würden kaum wahrgenommen werden, außer als Belästigung." Ja, möchte man den Autor trösten, vielleicht ist wirklich das Testosteron an allem schuld.
Denn diesem Buch mangelt es an jener Portion Geist und Witz, die den Leser mit der übellaunigen Misanthropie des Autors versöhnen könnte. Krausser ist nicht die Steigerung von Kraus. Seine Poetikvorlesungen ("Theorie war nie meine Stärke") drehen sich um Pathos, Präzision und Polemik - die seine, gegen die Kollegen oder die Literaturkritik, geht aber eher unpräzis zu Werke, mit dem Dreschflegel, nicht mit dem Florett. Über eine Schlingensief-Installation urteilt er bündig: "Meine Herren, was für ein Mist." Aber er muss ja "verkünden, nicht begründen".
Thomas Glavinic, als Schachspieler, Schriftsteller und Foto-Finsterling auf Kraussers Spuren, hat mit "Das bin doch ich" im Jahr 2007 vorgezeigt, wie ein Selbstporträt die Balance zwischen ironischer Egozentrik und Betriebssatire halten kann. "Deutschlandreisen" hingegen ist das Werk eines großen Autors, der sich ohne Not kleiner macht und als Mann in den besten Jahren weiß: "Auf den eigenen Verfall ästhetisch angemessen zu reagieren gelingt kaum noch wem." Vielleicht gelingt's mit dem nächsten Roman.
DANIELA STRIGL.
Helmut Krausser: "Deutschlandreisen".
Dumont Buchverlag, Köln 2014. 302 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main