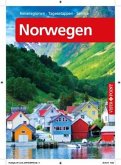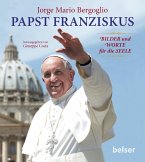Immer wieder werden Stimmen laut, auf den Schulhöfen unseres Landes solle nur Deutsch gesprochen werden. Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit wird häufig als Hindernis und Problem auf dem Weg zu guten Deutschkenntnissen wahrgenommen. Die neue Duden-Streitschrift - kurz und pointiert: auf 64 Seiten ein klares Plädoyer dafür, die sprachliche Vielfalt zu nutzen und Herkunftssprachen als gesellschaftlichen Mehrwert zu begreifen.
Hochdeutsch ist auch nur ein Dialekt?
Drei Linguistinnen ziehen gegen die Deutschpflicht in Schulen zu Felde und frönen dabei einer romantischen Sprachideologie
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder einzelne Schulen gegeben, deren Lehrer, Eltern und Schüler sich darauf einigten, dass Deutsch nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Pausenhof und auf Klassenfahrten gesprochen werden sollte. Oft handelte es sich dabei um Schulen in sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil an Migranten, in deren Klassen eine Vielzahl von Herkunftssprachen gesprochen wurde. Das erschwerte die Verständigung, beförderte die Abschottung zwischen den Schülergruppen und schwächte die Motivation, die eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern. Mit der gemeinsamen Schul sprache, so berichteten Lehrer, verbesserten sich das Klima und die Leistungen.
"Deutschpflicht auf dem Schulhof?" heißt ein Buch, das drei Linguistinnen, unter ihnen die medial bekannte "Kiezdeutsch"-Forscherin Heike Wiese, nun diesem Thema widmen. Aber die Titel-Frage wird nur rhetorisch gestellt, um sie sogleich mit Nachdruck zu verneinen. Die Autorinnen halten solche Regelungen für eine Diskriminierung von Migranten und eine Missachtung der Sprachenvielfalt und deren kulturellen Reichtums. Sie ziehen eine Parallele zur Unterdrückung der deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten während des Ersten Weltkriegs. Leider verzichten sie darauf, einen genaueren Blick auf die Fakten zu werfen: Deutsch wurde damals in Amerika als "Feindsprache" geschmäht, sein Gebrauch nicht nur in den Schulen, sondern in der Öffentlichkeit verboten, es gab sogar Bücherverbrennungen. Die bestehenden Regelungen zum "Schulhofdeutsch", die nicht auf Zwangsmaßnahmen, sondern auf Vereinbarungen beruhen, mit solchen Stigmatisierungen und Verfolgungen gleichzusetzen ist abwegig.
Auf den pädagogischen Notstand, auf den das "Pausenhofdeutsch" reagiert, gehen die Autorinnen nicht näher ein. Den Nutzen für den Unterricht bestreiten sie kurzerhand: Das Deutsch auf dem Schulhof unterscheide sich doch ohnehin völlig von dem formellen Standarddeutsch, das im Klassenzimmer erwartet werde. Doch anders als dieses Argument suggeriert, sind Umgangs- und Standarddeutsch natürlich nicht verschiedene Sprachen, sondern zwei Varianten derselben Sprache. Die Kenntnis des Umgangsdeutschs eröffnet auch einen Weg zur Bildungssprache. Und erst wer über die unterschiedlichen Stilebenen einer Sprache verfügt, beherrscht sie wirklich.
Finden die Verfasserinnen das nicht erstrebenswert? Auch das Argument, eine gemeinsame Sprache reduziere das Misstrauen, weil die Schüler mitbekommen, was andere über sie sagen, akzeptieren die Linguistinnen nicht: Despektierlich über andere zu reden sei schließlich auch nicht besser, wenn es auf Deutsch geschieht. Aber wie Erfahrungen zeigen, schafft das Schulhofdeutsch mehr Transparenz, es baut den Argwohn ab und fördert den wechselseitigen Respekt. Die Autorinnen gehen darüber hinweg, weil für sie auch in der Schule die Identitätsfunktion der einzelnen Herkunftssprachen mehr zählt als die kommunikative Funktion einer gemeinsamen Sprache.
Den Grundton des Buchs bildet die Kritik an einem vermeintlich vorherrschenden "monolingualen Habitus", für dessen Verbreitung und Intensität aber keine empirisch tragfähigen Daten präsentiert werden. Die behauptete Mentalität der Einsprachigkeit machen die Autorinnen dafür verantwortlich, dass deutsche Muttersprachler angeblich mit Mehrsprachigkeit fremdeln, Migrantensprachen und Soziolekte diskriminieren und zugleich das Standarddeutsche, also die Hoch- und Schriftsprache, maßlos überschätzen.
Für die Autorinnen ist Standarddeutsch hingegen auch nur ein "Dialekt" unter vielen, dessen Prestige allein daher rühre, dass "die Mittelschicht" ihn spricht, um sich sozial abzuheben. Die Entstehungszeit dieses "Dialekts" verlegen die Autorinnen in die Periode der Nationalstaatenbildung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, womit Standarddeutsch als ein nicht nur elitäres, sondern auch noch nationalistisches Projekt überführt ist.
Mit der historischen Realität hat all das freilich nicht viel zu tun. Tatsächlich liegen die Anfänge dessen, was wir heute Hoch- oder Standarddeutsch nennen, bereits in der frühen Neuzeit. Und von den Dialekten, in denen es ursprünglich wurzelte, entfernte es sich schnell. In den Kanzleien der Fürsten und den Kontoren der Kaufleute entstand eine überregionale Ausgleichssprache, die Basis für das heutige Schriftdeutsch. Angetrieben wurde diese Entwicklung von dem Wunsch, die dialektale Zersplitterung und die Abhängigkeit vom Lateinischen zu überwinden. Die Autorinnen schildern diese Epoche hingegen als zwangloses Idyll sprachlicher Diversität ohne Kommunikationsbarrieren. Zum Zeugen für diese historische Weichzeichnung rufen sie ausgerechnet Martin Luther mit seinen deutsch-lateinisch gemischten Tischreden auf. Keine Erwähnung findet Luthers Klage über die "mancherley Dialectos", deretwegen "die Leute in 30 Meilen Weges einander nicht wol können verstehen" - immerhin der entscheidende Impuls für die Spracharbeit des Reformators und das integrierende Deutsch seiner Bibelübersetzung.
Kein Wort bei den Autorinnen auch darüber, dass die Nutzung von Latein und Französisch, von ihnen als Beispiel für "kreative" Mehrsprachigkeit aufgeführt, auf die Eliten beschränkt blieb. Dort erfreuten sich diese Sprachen so großer Beliebtheit, weil sie eben die Eigenschaften aufwiesen, die die Autorinnen beim heutigen Standarddeutsch misstrauisch beäugen: Sie waren normiert, erlaubten eine elaborierte Kommunikation und hatten ein kulturelles Prestige, das dem regional zerklüfteten Deutsch abging.
Im letzten Teil ihres Buches plädieren die Autorinnen dafür, im Unterricht stärker zwischen Deutsch und den unterschiedlichen Herkunftssprachen der Schüler zu wechseln und Mehrsprachigkeit positiv zu thematisieren. Manches davon klingt sinnvoll, anderes angesichts der Herausforderungen in den Klassenzimmern eher unrealistisch. Das gilt wohl auch für die Forderung, vermehrt Arabisch oder Türkisch zu unterrichten. Dass im Fremdsprachenunterricht vor allem Englisch, Spanisch oder auch Chinesisch den Stundenplan bestimmen, beruht auf ihrer internationalen Bedeutung und dem damit verbundenen Nutzwert. Diese utilitaristische Einstellung mag man bedauern, mit einer Stigmatisierung der Migrantensprachen hat sie nichts zu tun. Dass das Buch den kognitiven und kulturellen Wert von Mehrsprachigkeit deutlich macht, ist durchaus zu begrüßen, nicht aber, dass deren mögliches Scheitern zugleich heruntergespielt wird: Die "doppelte Halbsprachigkeit" ist kein "längst entkräfteter Mythos", sondern ein nach wie vor kontrovers diskutierter Begriff. Nicht nur Lehrer und Sozialarbeiter in Kreuzberg oder Neukölln verwenden ihn, sondern auch Sprachwissenschaftler und Logopäden, weil sie finden, dass er ein reales Problem benennt.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Deutschunterrichts gehören Integration und die Vermittlung gleicher Bildungschancen. Die Abwertung des Standarddeutschen, die dieses Buch durchzieht, läuft dem zuwider. Sie speist sich aus einer romantischen Sprachideologie, die gleichzeitig pidginartige Stilregister wie "Kiezdeutsch" überhöht. Es geht bei all dem nicht, wie die Autorinnen behaupten, um eine Missachtung des kulturellen Werts, den jede Sprache und jede Mundart zweifellos hat, sondern um gesellschafts- und bildungspolitische Relevanz. Sie verleiht dem Standarddeutschen in der Schule Priorität vor den anderen Sprachen und ebenso vor allen Dia-, Sozio- und Ethnolekten. Es ist eine überregionale, in Jahrhunderten ausgebaute Bildungssprache, deren Wortschatz und Grammatik es ermöglichen, den eigenen Dunstkreis zu überschreiten und auch über abstrakte Inhalte aus Wissenschaft, Politik oder Kultur differenziert zu reden und zu schreiben. Eben deshalb haben auch die Autorinnen diese Sprachform für ihr Buch gewählt - und nicht Schwäbisch, Fränkisch oder Kiezdeutsch.
WOLFGANG KRISCHKE.
Heike Wiese, Rosemarie Tracy und Anke Sennema: "Deutschpflicht auf dem Schulhof?" Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen. Dudenverlag, Berlin 2020. 80 S., br., 8,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Drei Linguistinnen ziehen gegen die Deutschpflicht in Schulen zu Felde und frönen dabei einer romantischen Sprachideologie
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder einzelne Schulen gegeben, deren Lehrer, Eltern und Schüler sich darauf einigten, dass Deutsch nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Pausenhof und auf Klassenfahrten gesprochen werden sollte. Oft handelte es sich dabei um Schulen in sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil an Migranten, in deren Klassen eine Vielzahl von Herkunftssprachen gesprochen wurde. Das erschwerte die Verständigung, beförderte die Abschottung zwischen den Schülergruppen und schwächte die Motivation, die eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern. Mit der gemeinsamen Schul sprache, so berichteten Lehrer, verbesserten sich das Klima und die Leistungen.
"Deutschpflicht auf dem Schulhof?" heißt ein Buch, das drei Linguistinnen, unter ihnen die medial bekannte "Kiezdeutsch"-Forscherin Heike Wiese, nun diesem Thema widmen. Aber die Titel-Frage wird nur rhetorisch gestellt, um sie sogleich mit Nachdruck zu verneinen. Die Autorinnen halten solche Regelungen für eine Diskriminierung von Migranten und eine Missachtung der Sprachenvielfalt und deren kulturellen Reichtums. Sie ziehen eine Parallele zur Unterdrückung der deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten während des Ersten Weltkriegs. Leider verzichten sie darauf, einen genaueren Blick auf die Fakten zu werfen: Deutsch wurde damals in Amerika als "Feindsprache" geschmäht, sein Gebrauch nicht nur in den Schulen, sondern in der Öffentlichkeit verboten, es gab sogar Bücherverbrennungen. Die bestehenden Regelungen zum "Schulhofdeutsch", die nicht auf Zwangsmaßnahmen, sondern auf Vereinbarungen beruhen, mit solchen Stigmatisierungen und Verfolgungen gleichzusetzen ist abwegig.
Auf den pädagogischen Notstand, auf den das "Pausenhofdeutsch" reagiert, gehen die Autorinnen nicht näher ein. Den Nutzen für den Unterricht bestreiten sie kurzerhand: Das Deutsch auf dem Schulhof unterscheide sich doch ohnehin völlig von dem formellen Standarddeutsch, das im Klassenzimmer erwartet werde. Doch anders als dieses Argument suggeriert, sind Umgangs- und Standarddeutsch natürlich nicht verschiedene Sprachen, sondern zwei Varianten derselben Sprache. Die Kenntnis des Umgangsdeutschs eröffnet auch einen Weg zur Bildungssprache. Und erst wer über die unterschiedlichen Stilebenen einer Sprache verfügt, beherrscht sie wirklich.
Finden die Verfasserinnen das nicht erstrebenswert? Auch das Argument, eine gemeinsame Sprache reduziere das Misstrauen, weil die Schüler mitbekommen, was andere über sie sagen, akzeptieren die Linguistinnen nicht: Despektierlich über andere zu reden sei schließlich auch nicht besser, wenn es auf Deutsch geschieht. Aber wie Erfahrungen zeigen, schafft das Schulhofdeutsch mehr Transparenz, es baut den Argwohn ab und fördert den wechselseitigen Respekt. Die Autorinnen gehen darüber hinweg, weil für sie auch in der Schule die Identitätsfunktion der einzelnen Herkunftssprachen mehr zählt als die kommunikative Funktion einer gemeinsamen Sprache.
Den Grundton des Buchs bildet die Kritik an einem vermeintlich vorherrschenden "monolingualen Habitus", für dessen Verbreitung und Intensität aber keine empirisch tragfähigen Daten präsentiert werden. Die behauptete Mentalität der Einsprachigkeit machen die Autorinnen dafür verantwortlich, dass deutsche Muttersprachler angeblich mit Mehrsprachigkeit fremdeln, Migrantensprachen und Soziolekte diskriminieren und zugleich das Standarddeutsche, also die Hoch- und Schriftsprache, maßlos überschätzen.
Für die Autorinnen ist Standarddeutsch hingegen auch nur ein "Dialekt" unter vielen, dessen Prestige allein daher rühre, dass "die Mittelschicht" ihn spricht, um sich sozial abzuheben. Die Entstehungszeit dieses "Dialekts" verlegen die Autorinnen in die Periode der Nationalstaatenbildung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, womit Standarddeutsch als ein nicht nur elitäres, sondern auch noch nationalistisches Projekt überführt ist.
Mit der historischen Realität hat all das freilich nicht viel zu tun. Tatsächlich liegen die Anfänge dessen, was wir heute Hoch- oder Standarddeutsch nennen, bereits in der frühen Neuzeit. Und von den Dialekten, in denen es ursprünglich wurzelte, entfernte es sich schnell. In den Kanzleien der Fürsten und den Kontoren der Kaufleute entstand eine überregionale Ausgleichssprache, die Basis für das heutige Schriftdeutsch. Angetrieben wurde diese Entwicklung von dem Wunsch, die dialektale Zersplitterung und die Abhängigkeit vom Lateinischen zu überwinden. Die Autorinnen schildern diese Epoche hingegen als zwangloses Idyll sprachlicher Diversität ohne Kommunikationsbarrieren. Zum Zeugen für diese historische Weichzeichnung rufen sie ausgerechnet Martin Luther mit seinen deutsch-lateinisch gemischten Tischreden auf. Keine Erwähnung findet Luthers Klage über die "mancherley Dialectos", deretwegen "die Leute in 30 Meilen Weges einander nicht wol können verstehen" - immerhin der entscheidende Impuls für die Spracharbeit des Reformators und das integrierende Deutsch seiner Bibelübersetzung.
Kein Wort bei den Autorinnen auch darüber, dass die Nutzung von Latein und Französisch, von ihnen als Beispiel für "kreative" Mehrsprachigkeit aufgeführt, auf die Eliten beschränkt blieb. Dort erfreuten sich diese Sprachen so großer Beliebtheit, weil sie eben die Eigenschaften aufwiesen, die die Autorinnen beim heutigen Standarddeutsch misstrauisch beäugen: Sie waren normiert, erlaubten eine elaborierte Kommunikation und hatten ein kulturelles Prestige, das dem regional zerklüfteten Deutsch abging.
Im letzten Teil ihres Buches plädieren die Autorinnen dafür, im Unterricht stärker zwischen Deutsch und den unterschiedlichen Herkunftssprachen der Schüler zu wechseln und Mehrsprachigkeit positiv zu thematisieren. Manches davon klingt sinnvoll, anderes angesichts der Herausforderungen in den Klassenzimmern eher unrealistisch. Das gilt wohl auch für die Forderung, vermehrt Arabisch oder Türkisch zu unterrichten. Dass im Fremdsprachenunterricht vor allem Englisch, Spanisch oder auch Chinesisch den Stundenplan bestimmen, beruht auf ihrer internationalen Bedeutung und dem damit verbundenen Nutzwert. Diese utilitaristische Einstellung mag man bedauern, mit einer Stigmatisierung der Migrantensprachen hat sie nichts zu tun. Dass das Buch den kognitiven und kulturellen Wert von Mehrsprachigkeit deutlich macht, ist durchaus zu begrüßen, nicht aber, dass deren mögliches Scheitern zugleich heruntergespielt wird: Die "doppelte Halbsprachigkeit" ist kein "längst entkräfteter Mythos", sondern ein nach wie vor kontrovers diskutierter Begriff. Nicht nur Lehrer und Sozialarbeiter in Kreuzberg oder Neukölln verwenden ihn, sondern auch Sprachwissenschaftler und Logopäden, weil sie finden, dass er ein reales Problem benennt.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Deutschunterrichts gehören Integration und die Vermittlung gleicher Bildungschancen. Die Abwertung des Standarddeutschen, die dieses Buch durchzieht, läuft dem zuwider. Sie speist sich aus einer romantischen Sprachideologie, die gleichzeitig pidginartige Stilregister wie "Kiezdeutsch" überhöht. Es geht bei all dem nicht, wie die Autorinnen behaupten, um eine Missachtung des kulturellen Werts, den jede Sprache und jede Mundart zweifellos hat, sondern um gesellschafts- und bildungspolitische Relevanz. Sie verleiht dem Standarddeutschen in der Schule Priorität vor den anderen Sprachen und ebenso vor allen Dia-, Sozio- und Ethnolekten. Es ist eine überregionale, in Jahrhunderten ausgebaute Bildungssprache, deren Wortschatz und Grammatik es ermöglichen, den eigenen Dunstkreis zu überschreiten und auch über abstrakte Inhalte aus Wissenschaft, Politik oder Kultur differenziert zu reden und zu schreiben. Eben deshalb haben auch die Autorinnen diese Sprachform für ihr Buch gewählt - und nicht Schwäbisch, Fränkisch oder Kiezdeutsch.
WOLFGANG KRISCHKE.
Heike Wiese, Rosemarie Tracy und Anke Sennema: "Deutschpflicht auf dem Schulhof?" Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen. Dudenverlag, Berlin 2020. 80 S., br., 8,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Drei Linguistinnen ziehen gegen die Deutschpflicht in Schulen zu Felde und frönen dabei einer romantischen Sprachideologie
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder einzelne Schulen gegeben, deren Lehrer, Eltern und Schüler sich darauf einigten, dass Deutsch nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Pausenhof und auf Klassenfahrten gesprochen werden sollte. Oft handelte es sich dabei um Schulen in sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil an Migranten, in deren Klassen eine Vielzahl von Herkunftssprachen gesprochen wurde. Das erschwerte die Verständigung, beförderte die Abschottung zwischen den Schülergruppen und schwächte die Motivation, die eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern. Mit der gemeinsamen Schul sprache, so berichteten Lehrer, verbesserten sich das Klima und die Leistungen.
"Deutschpflicht auf dem Schulhof?" heißt ein Buch, das drei Linguistinnen, unter ihnen die medial bekannte "Kiezdeutsch"-Forscherin Heike Wiese, nun diesem Thema widmen. Aber die Titel-Frage wird nur rhetorisch gestellt, um sie sogleich mit Nachdruck zu verneinen. Die Autorinnen halten solche Regelungen für eine Diskriminierung von Migranten und eine Missachtung der Sprachenvielfalt und deren kulturellen Reichtums. Sie ziehen eine Parallele zur Unterdrückung der deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten während des Ersten Weltkriegs. Leider verzichten sie darauf, einen genaueren Blick auf die Fakten zu werfen: Deutsch wurde damals in Amerika als "Feindsprache" geschmäht, sein Gebrauch nicht nur in den Schulen, sondern in der Öffentlichkeit verboten, es gab sogar Bücherverbrennungen. Die bestehenden Regelungen zum "Schulhofdeutsch", die nicht auf Zwangsmaßnahmen, sondern auf Vereinbarungen beruhen, mit solchen Stigmatisierungen und Verfolgungen gleichzusetzen ist abwegig.
Auf den pädagogischen Notstand, auf den das "Pausenhofdeutsch" reagiert, gehen die Autorinnen nicht näher ein. Den Nutzen für den Unterricht bestreiten sie kurzerhand: Das Deutsch auf dem Schulhof unterscheide sich doch ohnehin völlig von dem formellen Standarddeutsch, das im Klassenzimmer erwartet werde. Doch anders als dieses Argument suggeriert, sind Umgangs- und Standarddeutsch natürlich nicht verschiedene Sprachen, sondern zwei Varianten derselben Sprache. Die Kenntnis des Umgangsdeutschs eröffnet auch einen Weg zur Bildungssprache. Und erst wer über die unterschiedlichen Stilebenen einer Sprache verfügt, beherrscht sie wirklich.
Finden die Verfasserinnen das nicht erstrebenswert? Auch das Argument, eine gemeinsame Sprache reduziere das Misstrauen, weil die Schüler mitbekommen, was andere über sie sagen, akzeptieren die Linguistinnen nicht: Despektierlich über andere zu reden sei schließlich auch nicht besser, wenn es auf Deutsch geschieht. Aber wie Erfahrungen zeigen, schafft das Schulhofdeutsch mehr Transparenz, es baut den Argwohn ab und fördert den wechselseitigen Respekt. Die Autorinnen gehen darüber hinweg, weil für sie auch in der Schule die Identitätsfunktion der einzelnen Herkunftssprachen mehr zählt als die kommunikative Funktion einer gemeinsamen Sprache.
Den Grundton des Buchs bildet die Kritik an einem vermeintlich vorherrschenden "monolingualen Habitus", für dessen Verbreitung und Intensität aber keine empirisch tragfähigen Daten präsentiert werden. Die behauptete Mentalität der Einsprachigkeit machen die Autorinnen dafür verantwortlich, dass deutsche Muttersprachler angeblich mit Mehrsprachigkeit fremdeln, Migrantensprachen und Soziolekte diskriminieren und zugleich das Standarddeutsche, also die Hoch- und Schriftsprache, maßlos überschätzen.
Für die Autorinnen ist Standarddeutsch hingegen auch nur ein "Dialekt" unter vielen, dessen Prestige allein daher rühre, dass "die Mittelschicht" ihn spricht, um sich sozial abzuheben. Die Entstehungszeit dieses "Dialekts" verlegen die Autorinnen in die Periode der Nationalstaatenbildung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, womit Standarddeutsch als ein nicht nur elitäres, sondern auch noch nationalistisches Projekt überführt ist.
Mit der historischen Realität hat all das freilich nicht viel zu tun. Tatsächlich liegen die Anfänge dessen, was wir heute Hoch- oder Standarddeutsch nennen, bereits in der frühen Neuzeit. Und von den Dialekten, in denen es ursprünglich wurzelte, entfernte es sich schnell. In den Kanzleien der Fürsten und den Kontoren der Kaufleute entstand eine überregionale Ausgleichssprache, die Basis für das heutige Schriftdeutsch. Angetrieben wurde diese Entwicklung von dem Wunsch, die dialektale Zersplitterung und die Abhängigkeit vom Lateinischen zu überwinden. Die Autorinnen schildern diese Epoche hingegen als zwangloses Idyll sprachlicher Diversität ohne Kommunikationsbarrieren. Zum Zeugen für diese historische Weichzeichnung rufen sie ausgerechnet Martin Luther mit seinen deutsch-lateinisch gemischten Tischreden auf. Keine Erwähnung findet Luthers Klage über die "mancherley Dialectos", deretwegen "die Leute in 30 Meilen Weges einander nicht wol können verstehen" - immerhin der entscheidende Impuls für die Spracharbeit des Reformators und das integrierende Deutsch seiner Bibelübersetzung.
Kein Wort bei den Autorinnen auch darüber, dass die Nutzung von Latein und Französisch, von ihnen als Beispiel für "kreative" Mehrsprachigkeit aufgeführt, auf die Eliten beschränkt blieb. Dort erfreuten sich diese Sprachen so großer Beliebtheit, weil sie eben die Eigenschaften aufwiesen, die die Autorinnen beim heutigen Standarddeutsch misstrauisch beäugen: Sie waren normiert, erlaubten eine elaborierte Kommunikation und hatten ein kulturelles Prestige, das dem regional zerklüfteten Deutsch abging.
Im letzten Teil ihres Buches plädieren die Autorinnen dafür, im Unterricht stärker zwischen Deutsch und den unterschiedlichen Herkunftssprachen der Schüler zu wechseln und Mehrsprachigkeit positiv zu thematisieren. Manches davon klingt sinnvoll, anderes angesichts der Herausforderungen in den Klassenzimmern eher unrealistisch. Das gilt wohl auch für die Forderung, vermehrt Arabisch oder Türkisch zu unterrichten. Dass im Fremdsprachenunterricht vor allem Englisch, Spanisch oder auch Chinesisch den Stundenplan bestimmen, beruht auf ihrer internationalen Bedeutung und dem damit verbundenen Nutzwert. Diese utilitaristische Einstellung mag man bedauern, mit einer Stigmatisierung der Migrantensprachen hat sie nichts zu tun. Dass das Buch den kognitiven und kulturellen Wert von Mehrsprachigkeit deutlich macht, ist durchaus zu begrüßen, nicht aber, dass deren mögliches Scheitern zugleich heruntergespielt wird: Die "doppelte Halbsprachigkeit" ist kein "längst entkräfteter Mythos", sondern ein nach wie vor kontrovers diskutierter Begriff. Nicht nur Lehrer und Sozialarbeiter in Kreuzberg oder Neukölln verwenden ihn, sondern auch Sprachwissenschaftler und Logopäden, weil sie finden, dass er ein reales Problem benennt.
Zu den wichtigsten Aufgaben des Deutschunterrichts gehören Integration und die Vermittlung gleicher Bildungschancen. Die Abwertung des Standarddeutschen, die dieses Buch durchzieht, läuft dem zuwider. Sie speist sich aus einer romantischen Sprachideologie, die gleichzeitig pidginartige Stilregister wie "Kiezdeutsch" überhöht. Es geht bei all dem nicht, wie die Autorinnen behaupten, um eine Missachtung des kulturellen Werts, den jede Sprache und jede Mundart zweifellos hat, sondern um gesellschafts- und bildungspolitische Relevanz. Sie verleiht dem Standarddeutschen in der Schule Priorität vor den anderen Sprachen und ebenso vor allen Dia-, Sozio- und Ethnolekten. Es ist eine überregionale, in Jahrhunderten ausgebaute Bildungssprache, deren Wortschatz und Grammatik es ermöglichen, den eigenen Dunstkreis zu überschreiten und auch über abstrakte Inhalte aus Wissenschaft, Politik oder Kultur differenziert zu reden und zu schreiben. Eben deshalb haben auch die Autorinnen diese Sprachform für ihr Buch gewählt - und nicht Schwäbisch, Fränkisch oder Kiezdeutsch.
WOLFGANG KRISCHKE.
Heike Wiese, Rosemarie Tracy und Anke Sennema: "Deutschpflicht auf dem Schulhof?" Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen. Dudenverlag, Berlin 2020. 80 S., br., 8,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main