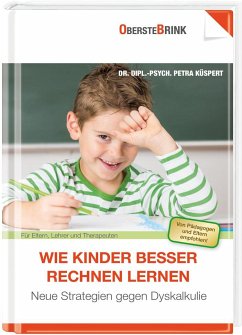Nicht lieferbar
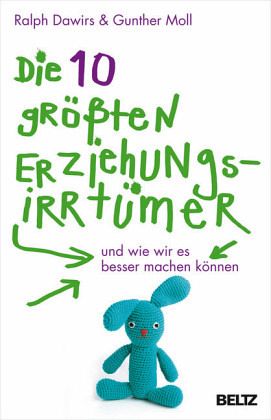
Die 10 größten Erziehungsirrtümer und wie wir es besser machen können
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Amüsant und unterhaltsam hinterfragen die beiden Hirnforscher Ralph Dawirs und Gunther Moll die Top Ten der Erziehungsirrtümer. Sie zeigen, warum sich diese einfach gestrickten und oft falschen Regeln so hartnäckig halten können und setzen ihnen eine moderne, entspannte Erziehung ohne dogmatische Zwänge entgegen."Iss deinen Teller leer!", "Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst ...", "Computer sind gefährlich.", "Nur die Leistung zählt.", ... Alte Sprüche von gestern? Leider nein! Viele Kinder müssen sich diese Sätze heute noch anhören, obwohl längst erwiesen ist, dass si...
Amüsant und unterhaltsam hinterfragen die beiden Hirnforscher Ralph Dawirs und Gunther Moll die Top Ten der Erziehungsirrtümer. Sie zeigen, warum sich diese einfach gestrickten und oft falschen Regeln so hartnäckig halten können und setzen ihnen eine moderne, entspannte Erziehung ohne dogmatische Zwänge entgegen.
"Iss deinen Teller leer!", "Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst ...", "Computer sind gefährlich.", "Nur die Leistung zählt.", ... Alte Sprüche von gestern? Leider nein! Viele Kinder müssen sich diese Sätze heute noch anhören, obwohl längst erwiesen ist, dass sie nicht weiterhelfen. Denn wie ein erzieherischer Bodensatz werden solche Erziehungsfallen unbewusst weitervererbt. Das macht es auch heutigen Eltern schwer, ihnen zu entgehen. Dieser gewitzte Ratgeber hilft ihnen weiter!
"Wer ist nicht schon einmal einem Irrtum aufgesessen? Schließlich ist Irren menschlich. Wir möchten Sie einladen, sich auf ein paar mögliche Irrtümer einzulassen." Ralph Dawirs, GuntherMoll
"Iss deinen Teller leer!", "Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst ...", "Computer sind gefährlich.", "Nur die Leistung zählt.", ... Alte Sprüche von gestern? Leider nein! Viele Kinder müssen sich diese Sätze heute noch anhören, obwohl längst erwiesen ist, dass sie nicht weiterhelfen. Denn wie ein erzieherischer Bodensatz werden solche Erziehungsfallen unbewusst weitervererbt. Das macht es auch heutigen Eltern schwer, ihnen zu entgehen. Dieser gewitzte Ratgeber hilft ihnen weiter!
"Wer ist nicht schon einmal einem Irrtum aufgesessen? Schließlich ist Irren menschlich. Wir möchten Sie einladen, sich auf ein paar mögliche Irrtümer einzulassen." Ralph Dawirs, GuntherMoll