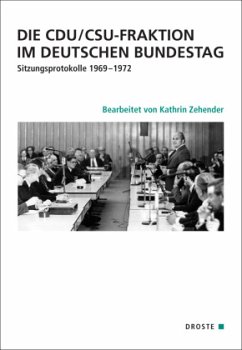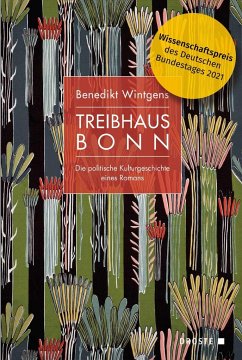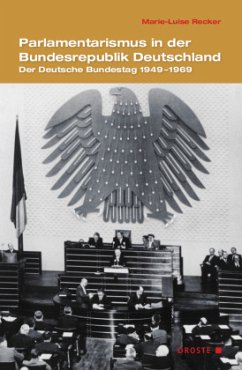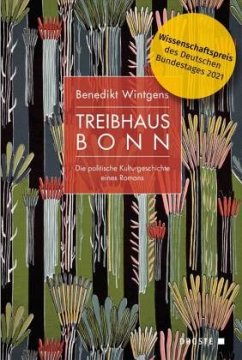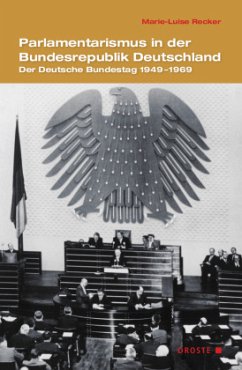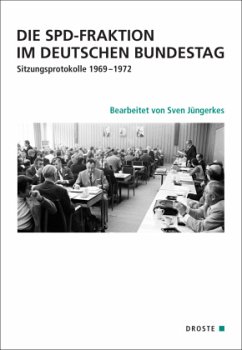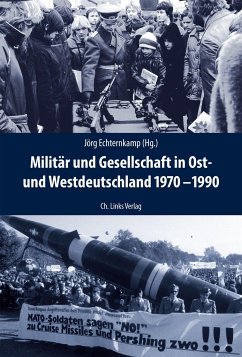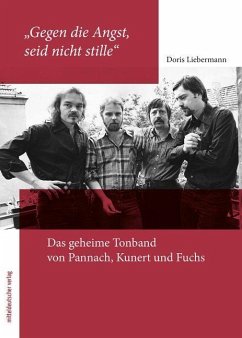Die 10. Volkskammer der DDR
Ein Parlament im Umbruch. Selbstwahrnehmung, Selbstparlamentarisierung, Selbstauflösung
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
49,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die 10. Volkskammer der DDR war ein außergewöhnliches Parlament. Als erste und gleichzeitig letzte frei gewählte Volksvertretung der DDR war sie im Frühjahr 1990 angetreten, an der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten mitzuwirken, die sich über vier Jahrzehnte im Kalten Krieg gegenübergestanden hatten. Ihr Auftrag war es, den Staat, dessen Bürger sie repräsentierte, schnellstmöglich abzuwickeln und somit sich selbst abzuschaffen. Diese Aufgabe musste von Abgeordneten bewältigt werden, die über keinerlei Erfahrungen mit der Funktionsweise des parlamentarischen Systems und sei...
Die 10. Volkskammer der DDR war ein außergewöhnliches Parlament. Als erste und gleichzeitig letzte frei gewählte Volksvertretung der DDR war sie im Frühjahr 1990 angetreten, an der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten mitzuwirken, die sich über vier Jahrzehnte im Kalten Krieg gegenübergestanden hatten. Ihr Auftrag war es, den Staat, dessen Bürger sie repräsentierte, schnellstmöglich abzuwickeln und somit sich selbst abzuschaffen. Diese Aufgabe musste von Abgeordneten bewältigt werden, die über keinerlei Erfahrungen mit der Funktionsweise des parlamentarischen Systems und seinen Arbeitsabläufen verfügten.Das Buch untersucht den Lernprozess der Neuparlamentarier und stützt sich dabei auch auf Videoaufzeichnungen der im DDR-Fernsehen live übertragenen Plenarsitzungen der Volkskammer. - Welche Vorstellungen hatten die Abgeordneten von ihrer Aufgabe, woran orientierten sie sich? Wie traten sie auf, wie redeten sie, wie verlief die Arbeit in Plenum und Fraktionen? - Konnte die 10. Volkskammer, wie manche Akteure rückblickend meinen, in der kurzen Zeit ihrer Existenz eine eigenständige parlamentarische Kultur entwickeln?
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.