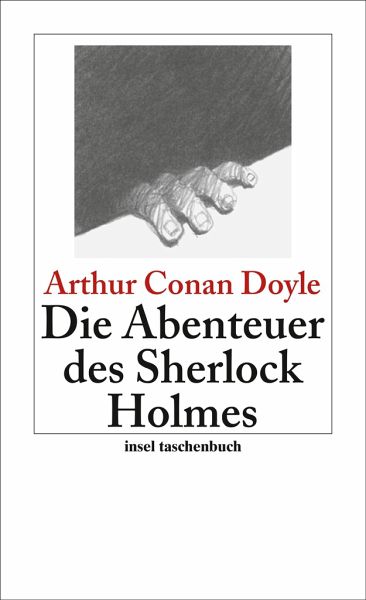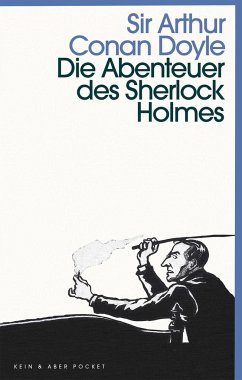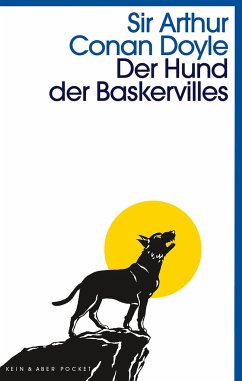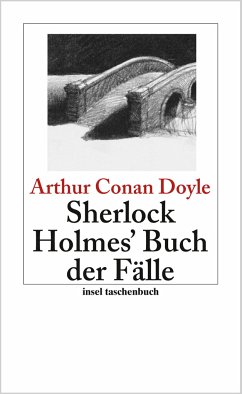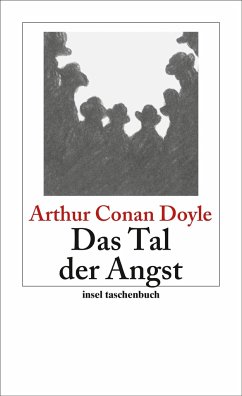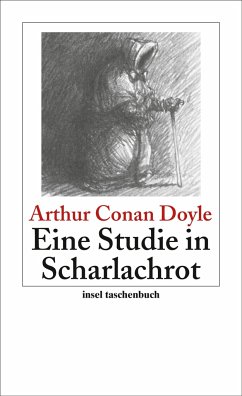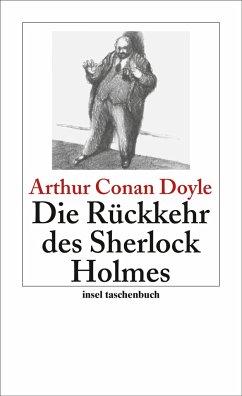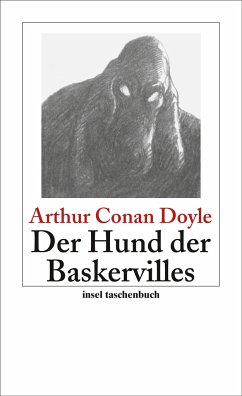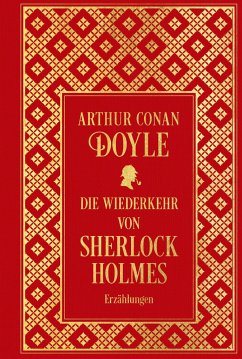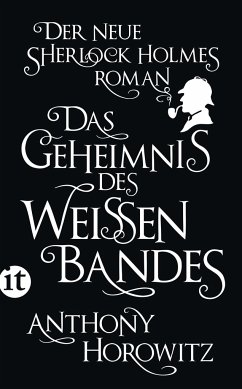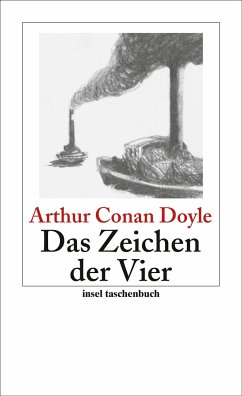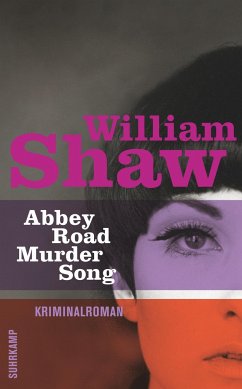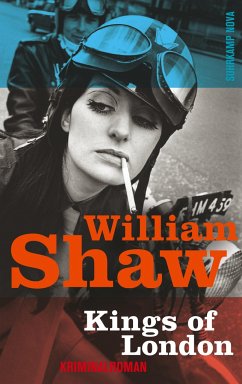Arthur Conan Doyle
Broschiertes Buch
Die Abenteuer des Sherlock Holmes
Sherlock Holmes - Seine sämtlichen Abenteuer
Übersetzung: Haefs, Gisbert
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





»Wenn ich meine Notizen und Aufzeichnungen zu Sherlock Holmes' Fällen zwischen 1882 und 1890 überfliege, stoße ich auf so viele, die seltsame und interessante Züge aufweisen, daß es mir nicht leicht wird, zu entscheiden, welche ich aufnehmen und welche ich ruhen lassen soll.« Dr. Watson berichtet von zwölf Fällen, in denen der Meisterdetektiv kuriose und geheimnisvolle Verbrechen löst. Obwohl er dabei wieder seine überragenden Fähigkeiten unter Beweis stellt, erlebt er auch eine herbe Niederlage.
Arthur Conan Doyle wurde am 22. Mai 1859 in Edinburgh geboren. Er absolvierte ein Medizinstudium und ließ sich zunächst als praktizierender Arzt in Portsmouth nieder. Erfolglos in seinem Beruf, entwickelte er in seiner Freizeit eine rege schriftstellerische Tätigkeit. Ab 1891 erschienen im "Strand Magazin" die schon bald berühmten Geschichten von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Im selben Jahr ging Doyle nach London, um dort – wiederum vergeblich – sein Glück als Arzt zu versuchen. Erneut verschaffte ihm das berufliche Scheitern die nötige Zeit zum Schreiben. Neben den Detektivgeschichten entstanden so in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Romane und Kurzgeschichten, darunter bekannte Werke wie The Lost World (Die verlorene Welt, erschienen 1912). Trotz der großen literarischen Erfolge beschränkte sich Doyle nicht auf seine Tätigkeit als Schriftsteller. Er nahm regen Anteil am politischen Geschehen und kandidierte zweimal – allerdings erfolglos – für das britische Parlament. 1902 wurde er als Auszeichnung für sein Engagement im südafrikanischen Burenkrieg (1899-1902) in den Adelsstand erhoben. Als einer der bekanntesten englischen Autoren seiner Zeit starb Sir Arthur Conan Doyle am 7. Juli 1930 in Windlesham, Sussex.

Foto: Wikipedia
Produktdetails
- Sherlock Holmes 3
- Verlag: Insel Verlag
- Artikelnr. des Verlages: IT 3317
- 10. Aufl.
- Seitenzahl: 432
- Erscheinungstermin: Dezember 2007
- Deutsch
- Abmessung: 176mm x 111mm x 25mm
- Gewicht: 264g
- ISBN-13: 9783458350170
- ISBN-10: 3458350179
- Artikelnr.: 22795354
Herstellerkennzeichnung
Insel Verlag GmbH
Torstraße 44
10119 Berlin
info@suhrkamp.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Für Friedrich Ani sind die Sherlock-Holmes-Kriminalerzählungen von Arthur Conan Doyle überhaupt ein idealer Einstieg in die Welt des Lesens, und er zeigt sich zudem von der Neuübersetzung von Gisbert Haefs restlos begeistert. Haefs, dessen schriftstellerischen Qualitäten bei der Übertragung voll zur Geltung kommen, wie der Rezensent preist, gelinge das Kunststück, die Kriminalerzählungen "zeitgemäß" und frisch klingen zu lassen und sie zugleich überzeugend im London Ende des 19. Jahrhunderts zu verankern, freut sich Ani. An Conan Doyles Erzählungen beeindruckt Ani stets aufs Neue die ausgeklügelte Erzählperspektive, den inspirierten Holmes durch die Augen des sehr viel nüchterner und naiver wirkenden Watson zu zeigen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Eine Sammlung von 12 Kurzgeschichten von Sherlock Holmes. Skandal in Böhmen, Die Liga der Rothaarigen, Eine Frage der Identität, Das Geheimnis vom Boscombe-Tal, Die fünf Orangenkerne, Der Mann mit der Fratze, Der blaue Karfunkel, das gefleckte Band, der Daumen des Ingenieurs, der …
Mehr
Eine Sammlung von 12 Kurzgeschichten von Sherlock Holmes. Skandal in Böhmen, Die Liga der Rothaarigen, Eine Frage der Identität, Das Geheimnis vom Boscombe-Tal, Die fünf Orangenkerne, Der Mann mit der Fratze, Der blaue Karfunkel, das gefleckte Band, der Daumen des Ingenieurs, der adlige Junggeselle, das grüne Diadem und Blutbuchen. Eben in typischer Manier wird weniger ein Geschehnisablauf beschrieben als vielmehr ein Problem erzählt, Holmes untersucht etwas nach einer ungenauen Beschreibung und lüftet dann das Geheimnis bzw. seine Erkenntnisse. Trotzdem eben Klassiker des Detektiv-Genre.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für