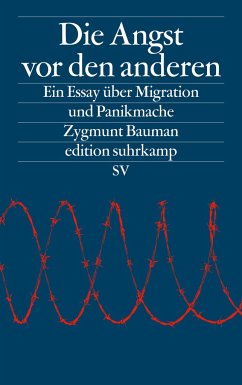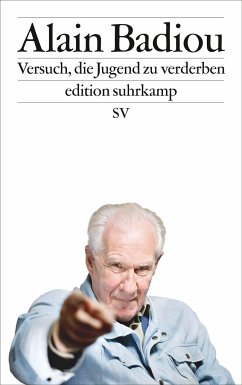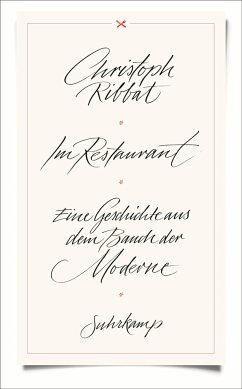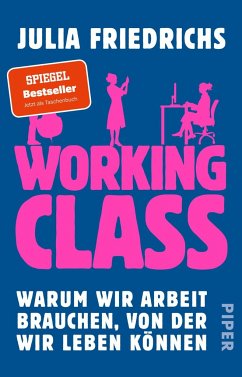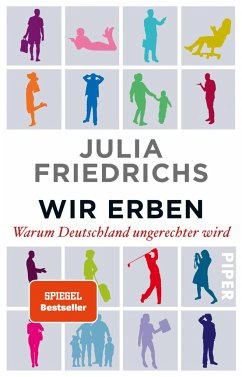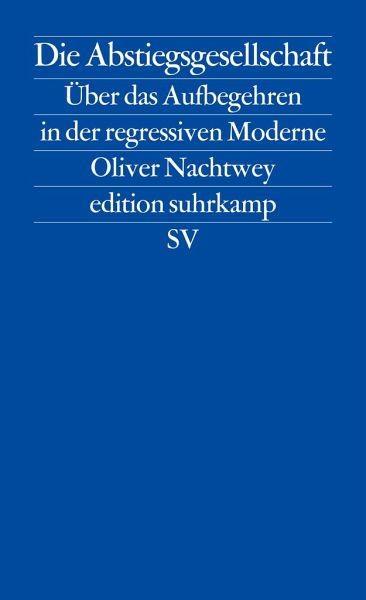
Die Abstiegsgesellschaft
Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs war eines der zentralen Versprechen der "alten" BRD - und tatsächlich wurde es meistens eingelöst: Aus dem Käfer wurde ein Audi, aus Facharbeiterkindern Akademiker. Mittlerweile ist der gesellschaftliche Fahrstuhl stecken geblieben: Uniabschlüsse bedeuten nicht mehr automatisch Status und Sicherheit, Arbeitnehmer bekommen immer weniger ab vom großen Kuchen. Oliver Nachtwey analysiert die Ursachen dieses Bruchs und befasst sich mit dem Konfliktpotenzial, das dadurch entsteht: Selbst wenn Deutschland bislang relativ glimpflich durch die Krise gekommen...
Die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs war eines der zentralen Versprechen der "alten" BRD - und tatsächlich wurde es meistens eingelöst: Aus dem Käfer wurde ein Audi, aus Facharbeiterkindern Akademiker. Mittlerweile ist der gesellschaftliche Fahrstuhl stecken geblieben: Uniabschlüsse bedeuten nicht mehr automatisch Status und Sicherheit, Arbeitnehmer bekommen immer weniger ab vom großen Kuchen. Oliver Nachtwey analysiert die Ursachen dieses Bruchs und befasst sich mit dem Konfliktpotenzial, das dadurch entsteht: Selbst wenn Deutschland bislang relativ glimpflich durch die Krise gekommen sein mag, könnten auch hierzulande bald soziale Auseinandersetzungen auf uns zukommen, die heute bereits die Gesellschaften Südeuropas erschüttern.