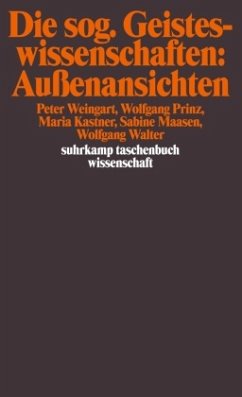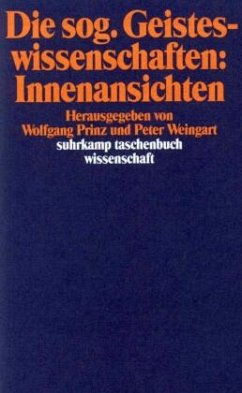Die akademische Elite
Zur sozialen Konstruktion wissenschaftlicher Exzellenz
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Als im Oktober 2006 die Eliteuniversitäten in München und Karlsruhe gekürt wurden, sagte Annette Schavan, Deutschland könne nun mithalten im internationalen Wettbewerb. Doch wer entscheidet überhaupt darüber, wer sich zur Elite zählen darf? Ist die Errichtung universitärer »Leuchttürme« ein wirksames Mittel gegen die Hochschulmisere?Diesen Fragen widmet Richard Münch seine brisante Studie. Das Ergebnis: Viele Reformen sind kontraproduktiv, sie führen zu einer Verringerung der theoretischen Vielfalt. »Eine Forschungspolitik, die solche Strukturen stärkt, ist nicht auf der Höhe d...
Als im Oktober 2006 die Eliteuniversitäten in München und Karlsruhe gekürt wurden, sagte Annette Schavan, Deutschland könne nun mithalten im internationalen Wettbewerb. Doch wer entscheidet überhaupt darüber, wer sich zur Elite zählen darf? Ist die Errichtung universitärer »Leuchttürme« ein wirksames Mittel gegen die Hochschulmisere?
Diesen Fragen widmet Richard Münch seine brisante Studie. Das Ergebnis: Viele Reformen sind kontraproduktiv, sie führen zu einer Verringerung der theoretischen Vielfalt. »Eine Forschungspolitik, die solche Strukturen stärkt, ist nicht auf der Höhe der Zeit und verpaßt die dynamisch voranschreitende internationale Entwicklung.«
Diesen Fragen widmet Richard Münch seine brisante Studie. Das Ergebnis: Viele Reformen sind kontraproduktiv, sie führen zu einer Verringerung der theoretischen Vielfalt. »Eine Forschungspolitik, die solche Strukturen stärkt, ist nicht auf der Höhe der Zeit und verpaßt die dynamisch voranschreitende internationale Entwicklung.«