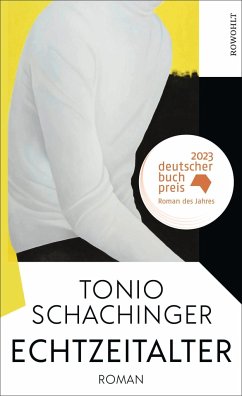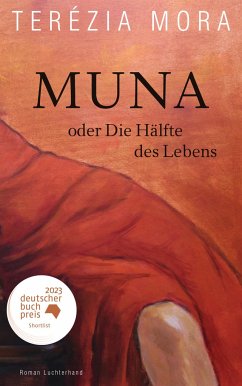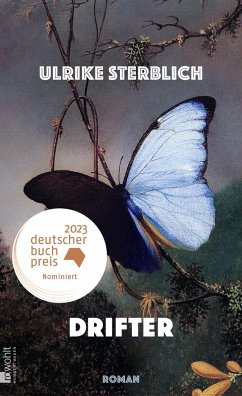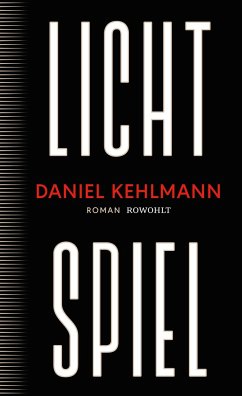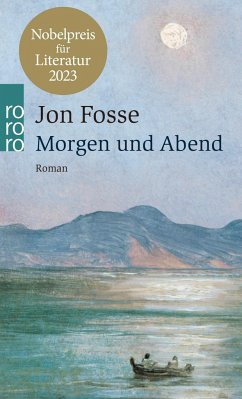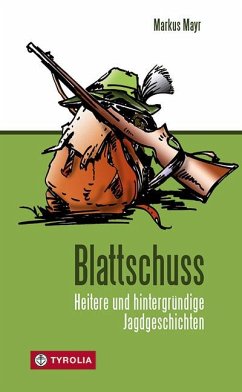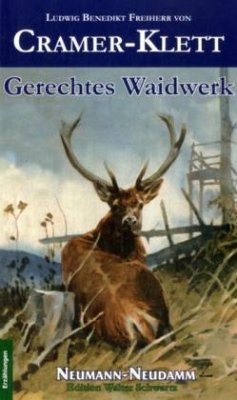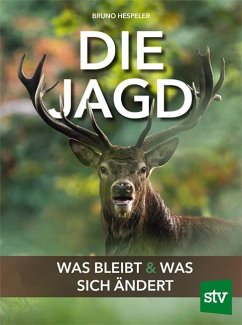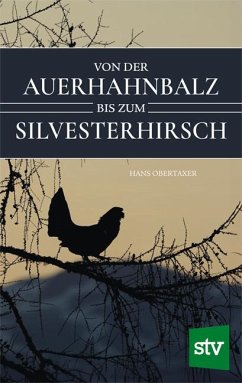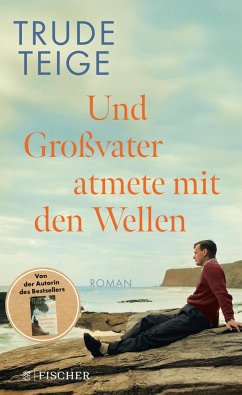Nicht lieferbar
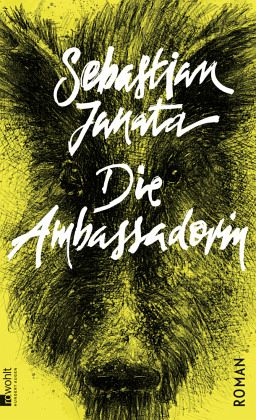
Die Ambassadorin
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Der junge Hugo Navratil muss zurück in die österreichische Provinz. Sein Großvater, mit dem ihn die Liebe zur Natur und der Tod eines kleinen Jagdhundes verband, ist gestorben, die Familie nimmt Abschied. Das burgenländische Dorf, der Wald, Freund und Feind, alles scheint wie immer. Doch auf der Beerdigung fallen Hugo zwei Frauen auf. Sie sind auf der Suche nach einer antiken Flinte - und sie glauben, dass Hugo weiß, wo sie ist. Je mehr Hugo es mit ihnen zu tun bekommt, desto besser versteht er, dass der alte Mann viele, durchaus schöne Gesichter hatte.Was hat es mit dem Verbund auf sich...
Der junge Hugo Navratil muss zurück in die österreichische Provinz. Sein Großvater, mit dem ihn die Liebe zur Natur und der Tod eines kleinen Jagdhundes verband, ist gestorben, die Familie nimmt Abschied. Das burgenländische Dorf, der Wald, Freund und Feind, alles scheint wie immer. Doch auf der Beerdigung fallen Hugo zwei Frauen auf. Sie sind auf der Suche nach einer antiken Flinte - und sie glauben, dass Hugo weiß, wo sie ist. Je mehr Hugo es mit ihnen zu tun bekommt, desto besser versteht er, dass der alte Mann viele, durchaus schöne Gesichter hatte.Was hat es mit dem Verbund auf sich, der ihn und diese Frauen einst zusammenbrachte?
«Die Ambassadorin» ist eine Ode an das Matriarchat und die Geschichte eines Antihelden, der unerschrockener kaum sein könnte. Sebastian Janatas Debüt ist humorvoll, skurril - und ganz und gar ajour.
«Die Ambassadorin» ist eine Ode an das Matriarchat und die Geschichte eines Antihelden, der unerschrockener kaum sein könnte. Sebastian Janatas Debüt ist humorvoll, skurril - und ganz und gar ajour.