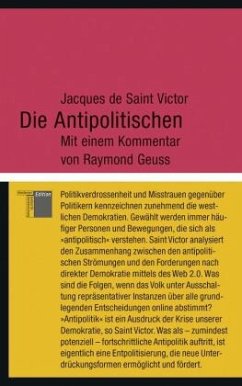Politikverdrossenheit und Misstrauen gegenüber Politikern kennzeichnen zunehmend die westlichen Demokratien. Gewählt werden immer häufiger Personen und Bewegungen, die sich als »antipolitisch« verstehen.
Saint Victor analysiert den Zusammenhang zwischen den antipolitischen Strömungen und den Forderungen nach direkter Demokratie mittels des Web 2.0. Was sind die Folgen, wenn das Volk unter Ausschaltung repräsentativer Instanzen über alle grundlegenden Entscheidungen online abstimmt?
»Antipolitik« ist ein Ausdruck der Krise unserer Demokratie, so Saint Victor. Was als - zumindest potentiell - fortschrittliche Antipolitik auftritt, ist eigentlich eine Entpolitisierung, die neue Unterdrückungsformen ermöglicht und fördert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Saint Victor analysiert den Zusammenhang zwischen den antipolitischen Strömungen und den Forderungen nach direkter Demokratie mittels des Web 2.0. Was sind die Folgen, wenn das Volk unter Ausschaltung repräsentativer Instanzen über alle grundlegenden Entscheidungen online abstimmt?
»Antipolitik« ist ein Ausdruck der Krise unserer Demokratie, so Saint Victor. Was als - zumindest potentiell - fortschrittliche Antipolitik auftritt, ist eigentlich eine Entpolitisierung, die neue Unterdrückungsformen ermöglicht und fördert.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.