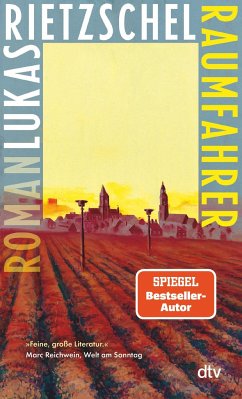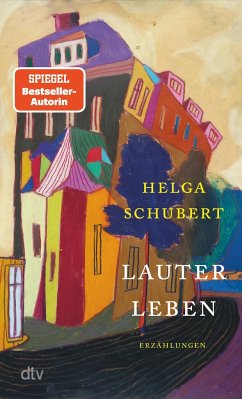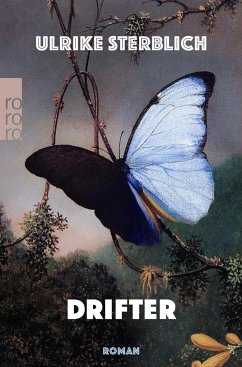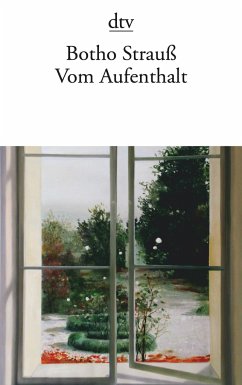Nicht lieferbar

Die atlantische Mauer
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die atlantische Mauer liegt zwischen der Neuen und der Alten Welt. Was treibt die Menschen auch heute dazu, ihr Leben hier aufzugeben und in den USA ein neues zu suchen? Selbst dann, wenn diese Menschen ihre Lebensmitte bereits überschritten haben. "Ich bin noch einige Schritte vom Altwerden entfernt - aber nahe genug schon dran, um zu wissen: Ich hab keine Stunde mehr zu verschenken. Nicht eine. So will ich nicht länger gelebt werden." In diese Worte faßt eine Frau aus Berlin den Entschluß, jegliche Bindung ans Altvertraute zu kappen und das Leben in New York nach ihren ureigensten Wünschen zu beginnen. Um so ernüchternder dann, den ersten Anlauf ins Gelobte Land verpatzt zu haben und wieder zurück zu müssen nach Berlin.
Die Veränderungen im Lebens- und Stadtraum Berlin haben einen Menschen-Typus geformt, der ebenfalls den Wandel bezeichnet: arbeitslos, heimatlos, ruhelos. Sehr verschiedene Menschen, die jedoch in einem übereinstimmen: für die Verwirklichung ihrer Liebe und ihres Glücksanspruchs vieles daranzusetzen, an Intrigen und Verrat nicht zu verzweifeln, selbst wenn sie dafür um die halbe Welt gestoßen werden und manchmal auch abprallen an der atlantischen Mauer.
Die Veränderungen im Lebens- und Stadtraum Berlin haben einen Menschen-Typus geformt, der ebenfalls den Wandel bezeichnet: arbeitslos, heimatlos, ruhelos. Sehr verschiedene Menschen, die jedoch in einem übereinstimmen: für die Verwirklichung ihrer Liebe und ihres Glücksanspruchs vieles daranzusetzen, an Intrigen und Verrat nicht zu verzweifeln, selbst wenn sie dafür um die halbe Welt gestoßen werden und manchmal auch abprallen an der atlantischen Mauer.