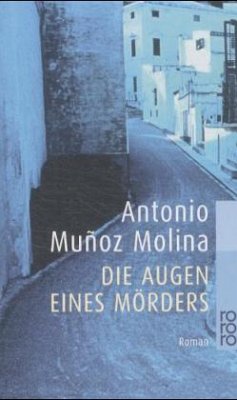In der kleinen südspanischen Stadt ist der Polizeiinspektor ein Außenseiter. Erst kürzlich zugezogen, umgeben ihn Gerüchte über seine Vergangenheit als Terroristenjäger und als einstiger Spitzel unter Franco. Als mehrere Morde passieren, sucht er den Mörder mit der Bessenheit eines Menschen, der sein persönliches Unglück zu kompensieren versucht. Der Autor entlarvt die Lebenslüge des Inspektors als Lebenslüge einer Gesellschaft, die das Vergessen sucht, um mit ihrer Vergangenheit Frieden schließen zu können.

Antonio Muñoz Molina versöhnt den Thriller mit der Literatur
Wer gern Thriller liest und trotzdem nicht vergessen kann, dass sie der Literatur angehören, muss auf Enttäuschungen gefasst sein. Patricia Cornwell, früher einmal eine überraschende Autorin, ist nach bald zehn Büchern in den Niederungen der seriellen Produktion versackt. Auch der beste Thriller-Schreiber dieser Tage, Thomas Harris, hat seine Leser auf hohem Niveau enttäuscht. "Hannibal", die lang erwartete Fortsetzung seines Bestsellers "Das Schweigen der Lämmer" (1989), bietet dämonische Figuren, erlesene Schauplätze auf drei Kontinenten, ausgefallene Tötungsmethoden und sogar eine Herde sardischer Wildschweine, die dem grausigen Geschäft einen borstigen Exotismus verleihen. Doch als Ganzes - als Literatur statt als Kompilation von Spezialeffekten - wirkt der Roman ausgetüftelt und leblos. Von neueren Romanen hören wir vor allem, dass ihre Serienmörder und Serienmörderinnen das Handwerk mit Säge und Tranchiermesser sagenhaft beherrschen: Anatomiestunden als literarisches Genre. Es leuchtet ein, dass man dieses Phänomen erst einmal beschreiben muss, bevor man es bewertet; aber warum dabei ausschließlich forensische Kriterien gelten sollten, ist nicht recht zu begreifen. Der schlichten Frage, ob all diese Ware, die als Dokument unserer Unterhaltungsbedürfnisse, aber auch der Abstumpfung soziologisch bedeutsam sein mag, ästhetisch etwas tauge, gehen die Propagandisten des süßen Schauders lieber aus dem Weg.
Ausgerechnet aus Spanien ist gerade ein erstaunliches Gegenstück zur tristen Serienmörderkonfektion nach Deutschland gekommen: der Roman "Die Augen eines Mörders" von Antonio Muñoz Molina, den Willi Zurbrüggen mit außergewöhnlichem Stilempfinden übersetzt hat. Was hat dieses Buch, das andere Thriller nicht haben? Zunächst fällt auf, dass es nicht von einem Profi des Gewerbes verfasst wurde. Der 1956 im südspanischen Úbeda geborene Muñoz Molina zählt zu den ernsthaften Literaten im Lande und hat bedeutende Auszeichnungen erhalten. Zu seinen unbestrittenen Talenten gehört, sich mühelos in verschiedenen Genres bewegen zu können. Er schreibt dicke Romane und dünne, Erzählungen und Essays.
Neigte er früher in seinen Zeitungskolumnen zu einer etwas rabaukenhaften Linksgläubigkeit, ist er inzwischen zu einem Skeptiker der Mitte geworden; und seit er mit neununddreißig Jahren, so früh wie niemand zuvor, in die Königliche Akademie gewählt wurde, darf er sogar als Musterknabe der spanischen Literatur gelten.
Muñoz Molinas Roman "Die Augen eines Mörders" schafft es bravourös, das alte Spiel von der doppelten Jagd noch einmal zu erzählen: weil der Schauplatz stimmt, die Figuren stimmen und selbst die beachtliche Strecke von 480 Seiten stimmt. Ein Inspektor, schon weit über fünfzig, mit gelichtetem Haar und alkoholischer Vergangenheit, wird vom Baskenland in eine südspanische Kleinstadt versetzt. Dort hat ein Unbekannter ein zehnjähriges Mädchen verschleppt, missbraucht und ermordet. Man befürchtet, er werde abermals töten.
Einsam und misstrauisch stapft der Inspektor durch die Stadt, immer dieselben Wege, und sieht den Leuten forschend in die Augen, als müsste sich die ungeheuerliche Tat im Flackern des Blicks zu erkennen geben (ein alter Pater hat ihm von den Augen als "Spiegel der Seele" erzählt). Doch Muñoz Molina, der genug von der Seele versteht, holt dann doch nicht die Theologie in den Kriminalroman zurück. Wie im wirklichen Leben entscheiden Fahndungsmethoden, Glück und Geduld.
Der introvertierte Ermittler interessiert dabei als Mensch ebenso wie als Polizist. Ehemals Informant im Franco-Regime, hat er im Baskenland lange Jahre den Eta-Terror bekämpft und sich und seine Ehe aufgerieben; jetzt liegt seine Frau im Sanatorium, umsorgt von Ordensschwestern und Valium, während er selbst sich schematisch durch die Tage hangelt und immer noch erwartet, eine Bombe unterm Auto zu entdecken oder in den Hinterhalt eines Eta-Killers zu geraten. Täglich nimmt er einen anderen Weg zum Polizeipräsidium, merkt sich die Kennzeichen verdächtiger Autos und sitzt im Restaurant mit dem Gesicht zur Tür. Ein Wrack, das Coca-Cola trinkt und nur noch seinem Schnüfflerinstinkt folgt, um den Mörder, der zu wenige Spuren hinterließ, zur Strecke zu bringen.
Muñoz Molina gruppiert um diese gebrochene Figur eine Szenerie, die man zu atmen und zu schmecken meint, Bars, Landstraßen, verwaiste Parks und stumme Monumente. Mitspieler wachsen aus den Kapiteln hervor wie Äste: die Klassenlehrerin des ermordeten Mädchens, die tapfer in der Provinz ausharrt und irgendwann glaubt, sie und der Inspektor könnten ein Paar werden (er glaubt es auch); der Gerichtsmediziner, der Camus und Quevedo liest und der Ansicht ist, mit den Toten verstehe man sich besser; die Eltern der Ermordeten, in deren armseliger Wohnung der Fernseher über Trauer und Fassungslosigkeit hinwegdröhnt; und der alte Pater, ein heroischer Bettelmönch aus anderer Zeit. Muñoz Molina benutzt keine Figur als Staffage, er braucht sie alle, um neben seiner Kriminalgeschichte in langen nachhallenden Sätzen ein spanisches Gesellschaftspanorama zu entwerfen, das von Schuld, Verdrängen und Verschweigen handelt.
Das schließt den Mörder ein, den der Leser früher kennt als der Inspektor und dessen Hände in einer dreiseitigen Arie besungen werden. Der Autor vollbringt hier das rare Kunststück, dem Täter fast inquisitorisch auf die Pelle zu rücken und ihm zugleich seine bedrohlich verquere Individualität zu lassen. Erbarmen leistet sich nur Muñoz Molinas forschender Stil; ansonsten steht fest, dass dieser Mörder nicht zu romantisieren, zu verteufeln oder sozialtherapeutisch zu vereinnahmen ist: ein unnahbar Fremder.
Anthony Trollope (1815 bis 1882) schreibt in seiner Autobiographie von der Unterscheidung zwischen "sensational" und "anti-sensational novels", die für das viktorianische Publikum offenbar ihre Gültigkeit hatte: hier eine literarische Abteilung für Drama, Mord und Totschlag, dort eine zweite für das Edle und zweifellos Langweiligere.
Trollope selbst erkannte diese Trennung nicht an. Nur mittelmäßige Schriftsteller, so fand er, ließen sich die Figuren von einem reißerischen Plot aus den Händen nehmen; und nur mittelmäßige glaubten andererseits, auf Spannung verzichten zu können. "Ich könnte Ihnen von einer ermordeten Frau erzählen", schreibt er, "ermordet in Ihrer Straße, im Haus nebenan; dass sie von ihrem eigenen Ehemann ermordet wurde; dass sie noch vor kaum einer Woche den Brautschleier trug." Er könne bis in alle Ewigkeit eins aufs andere setzen, fährt Trollope fort, dass etwa der Mörder seine Frau bei lebendigem Leibe gebraten, dass er eine zweite und dritte Ehefrau auf die gleiche Weise getötet habe und so weiter. Doch nichts sei öder und nutzloser, als wenn die Romankunst sich damit beschäftige, Grausamkeiten aufeinanderzustapeln; vielmehr gehe es darum, die menschliche Wahrheit sichtbar zu machen.
Eben diese Qualität hebt Muñoz Molinas Roman "Die Augen eines Mörders" aus der Masse der Kriminalliteratur heraus. Deshalb benutzt der Autor seinen grellen Stoff vor allem dazu, eine Hand voll Menschen für ein paar Wochen - von Vollmond zu Vollmond, wie der spanische Originaltitel "Plenilunio" nahe legt - aneinander zu fesseln. So gut ist er darin, dass die Unterscheidung zwischen Thriller und Literatur ausnahmsweise hinfällig wird. Wie damals, als Dürrenmatt "Das Versprechen" schrieb.
PAUL INGENDAAY.
Antonio Muñoz Molina: "Die Augen eines Mörders". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Willi Zurbrüggen. Rowohlt Verlag, Reinbek 2000. 478 S., geb., 42,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Sehen und gesehen werden. taz