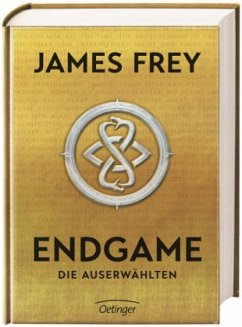Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Das Faszinierende an James Freys "Endgame" ist sicherlich nicht der Roman selbst, so Sven Stillich, der erste Teil der Trilogie ist bestenfalls mittelmäßig, in seiner überbordenden Brutalität und seiner Betonung des Völkischen oft sogar ziemlich krude, findet der Rezensent. Zwölf Jugendliche unterschiedlicher Völker wurden von Kindesbeinen an zu Mördern ausgebildet, als zwölf Meteoriten auf der Erde einschlagen, beginnt der Kampf um das Überleben des je eigenen Volkes zwischen ihnen, das Endgame, fasst Stillich zusammen, jeder hat seine holzschnittartigen Fähigkeiten und die allermeisten Handlungen bestehen nur im Ausführen ebendieser. "Endgame" ist aber mehr als ein Buch, weiß der Rezensent, es ist ein multimediales Projekt, ein "Buch-Film-Handyspiel-3-Millionen-Dollar-Rätsel-Internet-Projekt". Die Filmrechte waren schon vor der Veröffentlichung verkauft, Google arbeitet an einer möglichst innovativen Spielvariante, und in allen Büchern werden Unmengen von Rätseln versteckt, deren Lösung große Geldsummen verheißen, erklärt Stillich, der trotz aller Kritik am Buch ahnt, dass Frey wahrscheinlich einen Bestseller programmiert hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie brutal darf ein Jugendbuch eigentlich sein?
Wer sich mit Kinder- und Jugendbüchern beschäftigt, konnte in den Jahren seit "Harry Potter" eine verblüffende Entwicklung feststellen: Die Literatur für junge Leser hat längst auch die älteren erreicht, Jugendbücher wie aktuell John Greens "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" oder Kerstin Giers Zeitreisetrilogie ("Rubinrot") gelten auch in den Händen Erwachsener nicht als Anzeichen von Zurückgebliebenheit, und auf dem Buchmarkt besitzt dieses Genre ein Gewicht, von dem man früher nicht zu träumen wagte.
Seit allerdings allen klar ist, dass man mit diesen Büchern sehr viel Geld verdienen kann, spült dies auch eine Reihe unerfreulicher Erscheinungen auf die Verkaufsstapel in Kassennähe: geistlose, elend geschriebene Dutzendware, die sich inhaltlich besonders gern an bereits erfolgreiche Titel anlehnt. Das kann man achselzuckend hinnehmen und fragen, warum eigentlich die Verleger von Kinderbüchern ihre Kunden besser behandeln sollten als ihre Kollegen aus dem Erwachsenensegment, denen ja auch stapelweise Unfug angeboten wird. Oder man kann auf die besondere Verantwortung derer pochen, die es mit einer jungen, neugierigen und verführbaren Leserschaft zu tun haben.
Genau deshalb kann man auch, wie ein Kritiker kürzlich im Deutschlandfunk, den ehrwürdigen Oetinger Verlag fragen, was man sich dort dabei gedacht hat, als man den Roman "Endgame" von James Frey ins Programm genommen hat. Es geht darin um einen seltsamen Wettstreit zwischen zwölf auserwählten Jugendlichen, deren über den Erdball verstreut lebende Familien vor Jahrtausenden von Außerirdischen mit einer Art Geheimwissen ausgestattet worden sind. Seitdem trainieren in jeder Generation neu die Jugendlichen allerlei kognitive und körperliche Fähigkeiten, die ihnen dabei helfen sollen, die anderen Teilnehmer des Endspiels aus dem Weg zu räumen - so die Prophezeiung.
Lustig wäre nun die Schilderung all der vergeblichen Trainingsmühe über die Jahrtausende hinweg, und verplappern darf sich ja auch keiner. Aber mit Humor hat es James Frey nicht so. Deshalb setzt "Endgame" erst ein, als Kometeneinschläge - darunter tut der Autor es nicht - das Startsignal für den finalen Wettkampf geben. Die zwölf Kämpferinnen und Kämpfer werden zum selben Ort einbestellt. Wer gewinnt, dessen Angehörigen sollen ein kommendes Inferno überleben. Die Familien der anderen nicht.
Die fraglos hanebüchene Geschichte nimmt sich leider schrecklich ernst und entwickelt so auch keinen splatterhaften Charme als Groteske. Natürlich stecken darin haufenweise Versatzstücke der Populärkultur, allem voran die "Tribute von Panem" von Suzanne Collins mit dem Kampf der Abgesandten aus zwölf Bezirken, von denen nur einer überleben darf - auch die weibliche Heldin, die eigentlich nicht kämpfen mag und zwischen zwei Männern steht, von denen der eine zupackt, der andere zögert, findet ihre Entsprechung in Freys Roman. Seine Heldin löst das Problem, in dem sie den sanfteren ihrer Liebhaber tötet.
Doch am auffallendsten ist "Endgame" durch den miserablen Stil. Frey - der einem größeren Publikum mit einem autobiographischen Roman bekannt wurde, der sehr viel weniger autobiographisch war als gedacht - heischt mit jeder Zeile um die emotionale Reaktion des Lesers, unterbricht den Lesefluss fortwährend durch Absätze, die der Sache wahrscheinlich Wucht verleihen sollen, aber sehr rasch langweilen, und reiht ein Klischee ans andere. Ernst nehmen müsste man so etwas nicht, und auch die crossmediale Kampagne, die das Buch in Form von Filmchen, Websites und einem Gewinnspiel um eine halbe Million Dollar unterstützen soll, hat "Endgame" noch nicht nachhaltig im oberen Bereich der Bestsellerlisten etabliert.
Dass der Roman dennoch eine gewisse Beachtung erfährt, liegt dann auch an der explizit geschilderten Gewalt, die das Buch durchzieht. Frey - oder ein gewisser Nils Johnson-Shelton, der mitgeschrieben hat - kriegt sich gar nicht mehr ein vor lauter Knochenbrechen, Halsaufschlitzen, Fingerabsäbeln und dergleichen mehr. "Endgame" könnte so im Kontext der aktuellen Diskussion um Gewaltdarstellungen im Jugendbuch gelesen werden und so mit Büchern wie "Bunker Diary" von Kevin Brooks oder Friedrich Anis "Die unterirdische Sonne" verglichen werden - in beiden Büchern, die im Frühjahr erschienen sind, geht es um Menschen, die gefangen gehalten und auf entsetzliche Weise gequält werden, und beide gerieten deshalb in die Kritik.
Der Unterschied ist freilich, dass uns die Protagonisten von Ani und Brooks nahegehen, weil wir sie als Menschen erleben, während Freys Kampfmaschinen kaum plastischer als Spielkarten sind. Bildungsforscher betonen gern das Vermögen von Jugendlichen, zwischen Fiktion und Realität besser unterscheiden zu können, als Eltern sich das vorstellen. Man möchte hinzufügen: Sie können auch zwischen gut und miserabel unterscheiden, zwischen spannend und gähnend langweilig.
TILMAN SPRECKELSEN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main