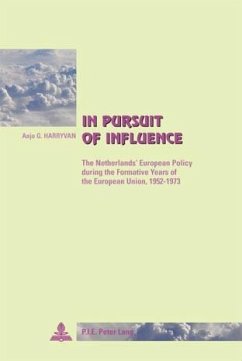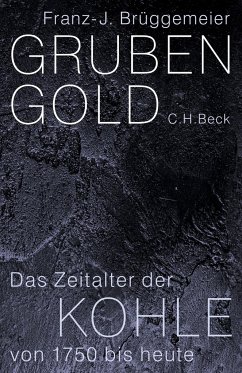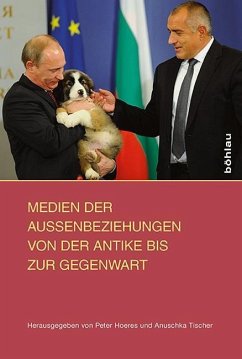ihre Regierungen bei der Europäischen Union akkreditiert, die Gemeinschaft selbst ist in 123 Ländern und bei fünf internationalen Organisationen vertreten, unterhält zu mehr als 120 Staaten vertragliche Beziehungen und ist an über 1200 Abkommen beteiligt.
So hat die EU zwar noch immer keine konsistente Außenpolitik, aber seit langem umfangreiche Außenbeziehungen. Das ist ein widersprüchlicher Befund, dem die historische Forschung bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt hat. Konzentriert auf die Perspektive der Mitgliedstaaten, hat sie die innerhalb der Gemeinschaft ausgetragenen Konflikte intensiv erforscht, wenig jedoch die Entfaltung gemeinschaftlicher Beziehungen mit Dritten, die von den europäischen Institutionen von Beginn an pragmatisch betrieben wurde. Die Studie von Claudia Becker-Döring stößt in ebendiese Forschungslücke und nimmt am Beispiel der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl konsequent die Perspektive der ersten supranationalen europäischen Behörde in den Blick. Sie tut dies noch dazu mit einem innovativen interdisziplinären Ansatz, der historische und juristische Methodik verbindet.
Aus den Archivalien der EGKS stellt die Verfasserin ausführlich die Entwicklung der administrativen Grundlagen, der diplomatischen Beziehungen und der Vertragsbeziehungen der Hohen Behörde im Untersuchungszeitraum dar. Eigene Kapitel sind dem passiven und dem aktiven Legationsrecht gewidmet, die beide von der Behörde als erster supranationaler Institution voll in Anspruch genommen wurden. Am Fallbeispiel des ersten Assoziationsabkommens, das die EGKS 1954 mit Großbritannien abschloß, führt Frau Becker-Döring vor, wie wegweisend gerade dieses Abkommen war, das in der Forschung gewöhnlich eher negativ bewertet wird. Hier zeigt sich exemplarisch der Gewinn des übernationalen Zugriffs. Wegen seines begrenzten materiellen Gehalts als reine Konsultationsvereinbarung ohne handelspolitische Substanz gilt das Abkommen allenthalben hauptsächlich als Ausweis der britischen Halbherzigkeit gegenüber den Einigungsbestrebungen des europäischen Kontinents. Aus gemeinschaftlicher Sicht jedoch war es eine "Neuschöpfung auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, die in den folgenden Jahren Schule machen sollte". Tatsächlich bilden die wesentlichen Vertragselemente unverändert die Handlungsbasis der Union im Umgang mit assoziierten Drittstaaten.
Die hier erstmals etablierte Praxis der sogenannten externen Assoziation wurde zum Vorbild aller nachfolgenden Assoziierungen der EWG nach Artikel 238 und ist noch immer ein Hauptinstrument der Außenbeziehungen der EU. Auch der seinerzeit ins Leben gerufene Assoziationsrat als Gremium im äußeren Rechtskreis der Gemeinschaft dient bis heute als Forum der Zusammenarbeit im Vorraum der regulären EU-Mitgliedschaft. Ebenso stilbildend war die mit dem britischen Assoziationsabkommen eingeführte Vertragsform des "accord mixte", der auf seiten der Gemeinschaft zwei Vertragspartner bestimmt: die Gemeinschaft selbst, 1954 vertreten durch die Hohe Behörde der EGKS, und die Mitgliedstaaten, die auf diesem Wege ihre Prärogative im Bereich der Außenpolitik wahren.
Vor diesem Hintergrund ist die Schlußfolgerung des Buches, daß "die Anfänge einer europäischen Außenpolitik in den Außenbeziehungen der EGKS zu erfassen sind", plausibel. Allerdings war und ist der Weg zu einer gemeinschaftlichen auswärtigen Politik außerordentlich dornig. Die Schwierigkeiten lagen von Anfang an weniger außerhalb als vielmehr innerhalb der Gemeinschaft. Vor allem Frankreich stellte sich einer Verselbständigung der europäischen Institutionen immer wieder entgegen und konterkarierte erst recht jeden Ansatz zu einer eigenständigen außenpolitischen Kompetenz. Die daraus hervorgegangenen höchst dramatischen Auseinandersetzungen zwischen den europäischen Partnerstaaten liefern den Historikern seit je dankbaren Stoff für fesselnde Lektüre. Solche Spannung kann das in vielerlei Hinsicht beispielhafte Werk von Claudia Becker-Döring nicht bieten. Damit teilt es das Schicksal seines Gegenstands: Der wegweisende supranationale und interdisziplinäre Forschungsansatz des Buches ist angesichts der Komplexität der Zusammenhänge - ähnlich wie die europäische Politik selbst - nicht leicht zu vermitteln.
DANIEL KOSTHORST
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
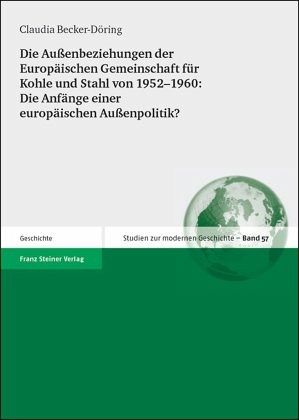




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.04.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.04.2004