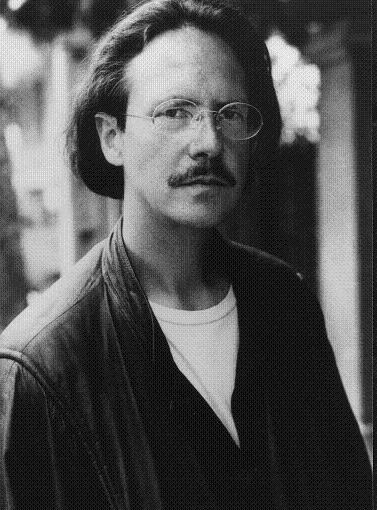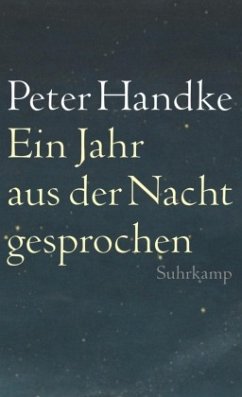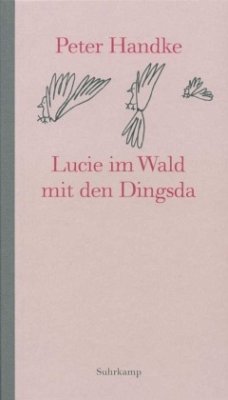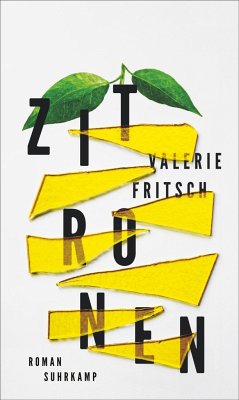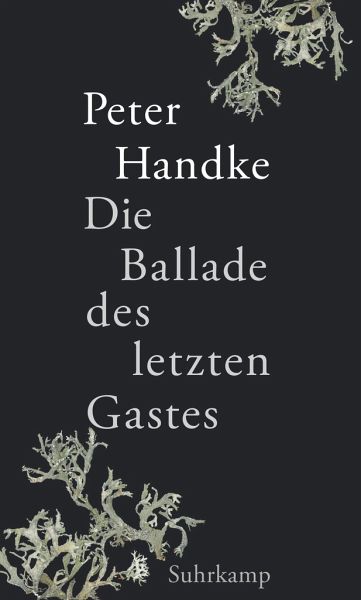
Die Ballade des letzten Gastes
Das neue Buch des Literaturnobelpreisträgers

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Das »vormalige Vieldörferland« ist eine städtische Agglomeration geworden, vertraut und zum Verirren fremd zugleich. Auch die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur die Todesnachricht, vom älteren der Familie verschwiegen, und Erinnerungen, zum Beispiel an den Unfall in den Brennesseln. Selbst der Obstgart...
Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Das »vormalige Vieldörferland« ist eine städtische Agglomeration geworden, vertraut und zum Verirren fremd zugleich. Auch die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur die Todesnachricht, vom älteren der Familie verschwiegen, und Erinnerungen, zum Beispiel an den Unfall in den Brennesseln. Selbst der Obstgarten ist ein anderer geworden, noch immer an Ort und Stelle, aber längst nicht mehr zu retten. Es zieht ihn also in die Straßen und Gassen, ins Kino, ins Fußballstadion, in den Wald, und er geht und geht immer weiter.
In Peter Handkes neuem Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Auf seinem Weg zurück zur Familie, durch einstmals bekannte Landschaften hält der Erzähler immer wieder inne, Kindheitserlebnisse werden wachgerufen, innere Stimmen treten ins Zwiegespräch. Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.
In Peter Handkes neuem Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Auf seinem Weg zurück zur Familie, durch einstmals bekannte Landschaften hält der Erzähler immer wieder inne, Kindheitserlebnisse werden wachgerufen, innere Stimmen treten ins Zwiegespräch. Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.