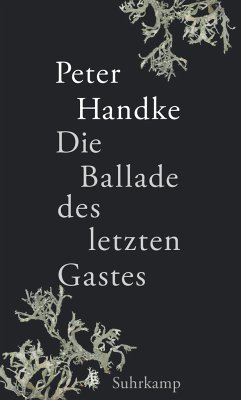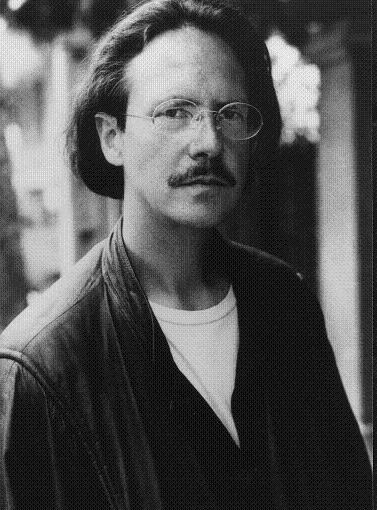Von einem anderen Erdteil kehrt Gregor zurück in die Heimat. Das »vormalige Vieldörferland« ist eine städtische Agglomeration geworden, vertraut und zum Verirren fremd zugleich. Auch die Familie hat sich verändert: Zwar wartet der Vater wie früher mit den Spielkarten, doch hat die Schwester überraschend einen Säugling auf dem Arm. Er, der große, ältere Bruder, soll der Taufpate des Kindes werden. Vom jüngeren Bruder Hans bleiben derweil nur die Todesnachricht, vom älteren der Familie verschwiegen, und Erinnerungen, zum Beispiel an den Unfall in den Brennesseln. Selbst der Obstgarten ist ein anderer geworden, noch immer an Ort und Stelle, aber längst nicht mehr zu retten. Es zieht ihn also in die Straßen und Gassen, ins Kino, ins Fußballstadion, in den Wald, und er geht und geht immer weiter.
In Peter Handkes neuem Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Auf seinem Weg zurück zur Familie, durch einstmals bekannte Landschaften hält der Erzähler immer wieder inne, Kindheitserlebnisse werden wachgerufen, innere Stimmen treten ins Zwiegespräch. Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.
In Peter Handkes neuem Buch durchdringen sich Gegenwart und Vergangenheit, scheint das eine ins andere zu kippen, steht alles »auf Messers Schneide«. Auf seinem Weg zurück zur Familie, durch einstmals bekannte Landschaften hält der Erzähler immer wieder inne, Kindheitserlebnisse werden wachgerufen, innere Stimmen treten ins Zwiegespräch. Was einmal war, hat sich unwiderruflich verändert - und bleibt dennoch vertraut.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Der alte Schwung ist noch nicht hin bei Peter Handke, freut sich Rezensent Eberhard Falcke. Das neue Buch des Nobelpreisträgers folgt wieder einmal einem Gregor, der sich diesmal in seinen Heimatort begibt, wo er von Familienangehörigen erwartet wird. Das Kind seiner Schwester soll getauft werden, erfahren wir, hauptsächlich macht dieser Gregor jedoch, was Handke-Figuren gerne tun: herumschweifen und Beobachtungen machen, die sich zu einer besonderen Form des epischen Schreibens fügen, einem, das wenig mit Erzählung und viel mit einem sich-Verlieren in der Welt zu tun hat. So geht die sich beständig selbst hinterfragende Hauptfigur, heißt es weiter, ins Kino oder auch in den Wald zu einem Bombentrichter, sowie in Kneipen, wo er gerne selbst die letzten Gäste bewirten würde. Trotz solcher Abschlussgedanken liest sich diese Ballade keineswegs wie ein Abschied, so Falcke, das Handke-Schreiben bleibt in Bewegung.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Phantasien des Widerstands: Peter Handkes "Ballade des letzten Gastes" ist ein Spätwerk gegen das Gewicht der Welt.
Von Jan Wiele
Während der Journalismus vielerorts Tiefpunkte seiner Geschichte erreicht, heruntergekommen zur Bedienung billiger Reize, zunehmend erstarrt zu Kachelsprüchen in Agentursprache, während der Mensch neben einem mit großem Ernst "kostenneutral", "Stand jetzt" oder "Wir müssen noch mal über das Wording nachdenken" in sein Telefon sagt: In dieser Lage ein Buch von Peter Handke aufzuschlagen wirkt fast wie ein Akt des Widerstands. Eines Widerstands gegen die festgelegte Sprache, den er tapfer weiter leistet, eines Widerstands gegen die Vereinnahmung des Einzelnen, der sich als einsamer Geher an den Rändern (und manchmal auch jenseits von jedem) dem Herdentrieb beständig entzieht, auch mit über achtzig Jahren noch, auch in seinem neuen Buch mit dem Titel "Die Ballade des letzten Gastes".
Wer Handkes Prosa nicht mag, wird darin seine Abneigung nur bestätigt finden; wer Handkes Prosa mag, findet fröhlich "more of the same" darin. "Er war im Leben immer wieder in die Irre gegangen, schon von Kindesbeinen an." Und: "Lieber Umwege nehmen, und möglichst spät, am liebsten erst in der tiefen Dämmerung heimkommen, oder überhaupt nicht eintreten in das doch wie einladend illuminierte Haus." Kennt man das nicht irgendwoher? Ist das nicht aus einem anderen, früheren Handke, könnte es nicht auch in "Langsame Heimkehr" stehen, in "Mein Jahr in der Niemandsbucht" oder in "Die Obstdiebin"? Ja, ohne Weiteres. Und noch viel mehr aus diesen und anderen Werken kommt einem hier bekannt vor, kehrt leicht verändert wieder wie in Versionen eines Lieds.
Die "Ballade des letzten Gastes", die natürlich keine im engeren Genre-Sinne ist, sondern ein Stück lyrischer, mit viel Literaturgeschichte angereicherter Journalprosa, hat eine vertraute Melodie und handelt von Busbahnhöfen, Ackerfurchen, Hochhäusern, Obstwiesen, Umgehungsstraßen, von der "großen Agglomeration im ehemaligen Vieldörferland", von Kino-Erinnerungen, Gedankenspielen und Albträumen, kleinen und größeren Wutausbrüchen; sie variiert zudem poetologische Lebensthemen Handkes. Gleich zu Beginn fühlt man sich an seine Büchnerpreisrede von 1973 erinnert, in der er unter Bezug auf Thomas Bernhard sagte, wenn ihm beim Schreiben auch nur der Ansatz eines Begriffs auftauche, weiche er aus "in eine andere Richtung, in eine andere Landschaft, in der es noch keine Erleichterungen und Totalitätsansprüche durch Begriffe gibt".
Nur wenig abgewandelt heißt es in der "Ballade" nun in Bezug auf Bilder: "Nur keine Bilder, und vor allem keine festumrissenen! Und wenn er doch dann und wann etwas 'Bildartiges' witterte, das ihn gleichsam hinterrücks anzufliegen drohte, tat er, in seinem Innern jedenfalls, einen Seiten- und Ausweichschritt wie auf einer Tanzfläche oder in einer Arena, und vorbei schoß der Bildpfeil." Das wiederum erinnert daran, dass Handke auch schon einen ganzen, sehr langen Roman namens "Der Bildverlust" geschrieben hat.
Er ist noch immer ein großer Ausweicher vor Bildern und Begriffen, der eben diesen Vorgang zu beschreiben zu seiner "Chronistenpflicht" macht, und wie schon in Bezug auf "Die Obstdiebin" (F.A.Z. vom 16. November 2017) kommt man nicht umhin zu fragen, ob Handkes Werk womöglich ein einziger, langer Traum ist, immer wieder sich verschiebend und verdichtend. Die "Ballade" ist dennoch besonders: Mehr als irgendetwas von Handke zuvor hat sie den Charakter eines Spätwerks, das die Vorstellung, "der Letzte zu sein", fast obsessiv variiert: in der nächtlich kreisenden Straßenbahn, an der Bar, auf dem Planeten.
In Schwarz ist das Buch getaucht; das erinnert an Johnny Cash oder Leonard Cohen am Ende ihres Weges. In der Erinnerungsjukebox des Handke-Erzählers, der hier Gregor heißt (aber nicht Keuschnig, sondern Werfer), stecken indes alte Schlager - denn dieses Buch handelt von einer Heimkehr zur Familie und teils auch in die Fünfzigerjahre. "Wir wollen niemals auseinandergehen": Das singen Mutter und Schwester gemeinsam in einer Szene aus der Kindheit, auch zittert der Erzähler bisweilen mit Grillparzer vor der "Begierde nach dem Zusammenhang", und doch ist und bleibt er einsamer Streuner. Nicht nur hat er keine Kinder, er ist auch nicht fähig, ein Kind zu berühren: So stark die Freiheit von Handkes Hobos oft beeindruckt, so sehr fragt man sich insbesondere in diesem Buch auch, ob sie in gewisser Weise lebensuntüchtig sind.
Das würde Handkes Erzähler womöglich auch gar nicht abstreiten, wobei er eben sein Glück im Alleinsein sucht. Schon als junger Mann kommt er nur noch für eine Woche im Jahr in die Heimat zurück, und als er, viel später, dabei einmal auch die Nachricht vom Kriegstod seines Bruders in der Fremdenlegion den Angehörigen überbringen muss, ist er ebenso überfordert wie einst mit der Patenschaft für das Kind seiner Schwester. Geschickt führt Handke in seiner Erzählung verschiedene Zeitebenen eng, was einen öfter rätseln lässt, in welcher man sich gerade befindet.
Bei aller Wut auf die Welt, die sich hier auch wieder in absurden, also spielerischen Schimpftiraden ausdrückt (das Kleinkind nennt der Erzähler "Furzkaspar" und "Speiteufel"; angesichts einer erotischen Kinoszene, die ihm nicht gefällt, fordert er die Einführung einer Diktatur, die so etwas verbietet), ist dem gealterten Troubadour aber auch ein Bedauern anzumerken, eine Erkenntnis des durch sein lebenslanges Fluchtverhalten Verpassten.
Es ist ein Buch der Trauerarbeit, das sich, springend auch durch verschiedene Erzählperspektiven, zur Chronik des verstorbenen Bruders, zu einer, wenn auch sehr untypischen Familienchronik mausert. Die Heimkehr-Thematik wird mit den Irrfahrten des Odysseus verbunden, und bei allen augenfälligen Unterschieden kann Handkes Erzähler auch, wenngleich manchmal nur in der Phantasie, zum Berserker werden. So wie manche Menschen ja lieber etwas zerstören, was sie oder ihre Vorfahren schon über lange Zeit aufgebaut haben, als es den Falschen zu hinterlassen, will "Gregor, der Letzte" einmal schon losberserkern und den alten Obstgarten mit der Motorsäge niedermähen. Das ist belustigend und traurig zugleich. Man bewundert an diesem bei aller Vertrautheit überraschenden, hakenschlagenden Buch abermals die große Unabhängigkeit des einsamen Wandersmannes, während man gleichzeitig erkennt, welchen Preis er für seine Art des Widerstandes bezahlen muss.
Peter Handke: "Die Ballade des letzten Gastes".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2023. 186 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Staunend fragt man sich als Leser, wie er das wieder hinbekommen hat, dieser Handke, mit seinen fein ausdifferenzierten Sätzen und fein verästelten Wahrnehmungsgespinsten.« Carsten Otte SWR-Bestenliste 20231203