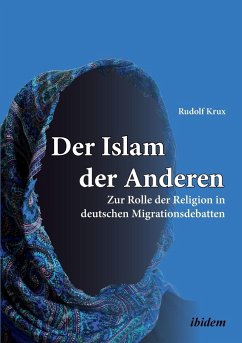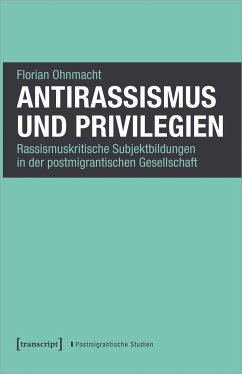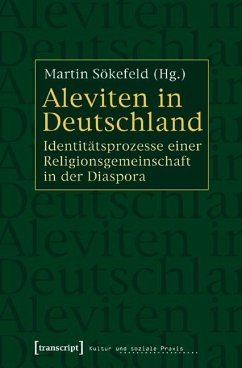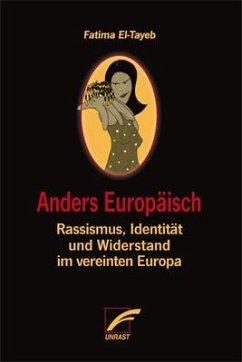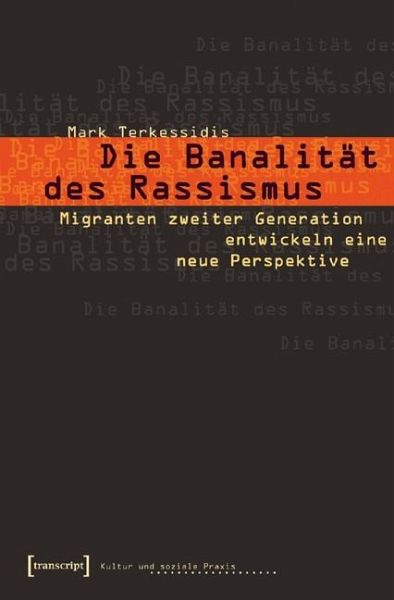
Die Banalität des Rassismus
Migranten zweiter Generation entwickeln eine neue Perspektive

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Beim Thema Rassismus denkt man hierzulande an jugendliche Gewalttäter oder unverbesserliche Neonazis. Doch die meisten Einwanderer haben mit Extremismus kaum eigene Erfahrungen. Was sie kennen, sind permanente, kleine Erlebnisse, in denen ihnen klar gemacht wird, dass sie keine Deutschen sind und dass sie woanders hingehören. In diesem Buch geben Migranten zweiter Generation Auskunft über diesen ganz banalen Rassismus. Sie erzählen, warum für sie Fragen wie »Woher kommen Sie?« oder »Sie sprechen aber gut Deutsch!« nicht nur naive Neugierde oder freundliches Lob bedeuten. Rassismus ist...
Beim Thema Rassismus denkt man hierzulande an jugendliche Gewalttäter oder unverbesserliche Neonazis. Doch die meisten Einwanderer haben mit Extremismus kaum eigene Erfahrungen. Was sie kennen, sind permanente, kleine Erlebnisse, in denen ihnen klar gemacht wird, dass sie keine Deutschen sind und dass sie woanders hingehören. In diesem Buch geben Migranten zweiter Generation Auskunft über diesen ganz banalen Rassismus. Sie erzählen, warum für sie Fragen wie »Woher kommen Sie?« oder »Sie sprechen aber gut Deutsch!« nicht nur naive Neugierde oder freundliches Lob bedeuten. Rassismus ist eben der Apparat, der Menschen systematisch zu »Fremden« macht.