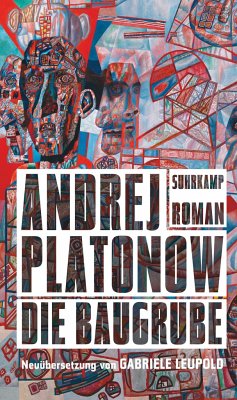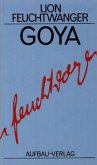Am Rand einer großen Stadt heben Arbeiter eine riesige Grube aus, um ein »gemeinproletarisches Haus« zu errichten. Vom Kriegsinvaliden über den Handlanger bis zum Ingenieur bildet sich unter den freiwilligen Sklaven eine Hierarchie, die den sozialen Verhältnissen in Stalins Sowjetunion ähnelt. Mit Nastja, dem Waisenkind, das sich nach seiner bourgeoisen Mutter sehnt, ist der »neue Mensch« bereits unter ihnen. Doch am Ende wird es in der Baugrube beerdigt, dem kollektiven Grab, das sich die »Paradieserbauer« (Brodsky) geschaufelt haben.Andrej Platonows Helden setzen alle ihre Kräfte ein, die glückliche Zukunft der Menschheit durch ihrer Hände Arbeit herbeizuführen - und werden doch von der Wucht dieser Aufgabe erdrückt: Sie versinken in Schwermut, leiden an Erschöpfung und Grübelsucht oder gehen zugrunde, weil es in der neuen Ordnung der Dinge keinen Platz mehr für sie gibt. Die Sprache kann mit dem utopischen Denken nicht Schritt halten, der Boden entgleitet ihr unter den Füßen.Wie kein zweiter Autor lässt Platonow die Atmosphäre einer Epoche spüren, die voll war von Utopien und Prophezeiungen einer künftigen Welt. Die russische Revolution, die alle Bereiche des Lebens in diesem riesigen Land erfasste, der Kampf um einen »neuen Himmel und eine neue Erde«, findet in seinem Werk einen unerhörten Ausdruck.Auf der Grundlage der 2000 in Sankt Petersburg erschienenen, erstmals edierten gültigen Originalausgabe hat Gabriele Leupold, gerühmt für ihre Übersetzungen von Andrej Belyjs Petersburg und Warlam Schalamows Erzählungen aus Kolyma, eine neue deutsche Fassung des als unübersetzbar geltenden Buches erarbeitet.

Als Sprache zum Gewaltinstrument wurde: Andrej Platonows literarisches Meisterwerk "Die Baugrube" aus dem Jahr 1930 erscheint in neuer Übersetzung
Befragt, ob sie gegenüber ihren Opfern Mitleid verspüre, antwortete die RAF-Terroristin Irmgard Möller einmal, sie könne, was sie getan habe, "nicht abstrahieren und zerlegen in solche Kategorien". Ist mit einem Menschen, in dessen Mund sich eine so unmittelbare Regung wie das Mitleid zum Inbegriff der Abstraktion verkehrt hat, überhaupt noch eine Verständigung möglich? Und was erst, wenn eine ganze Gesellschaft solch sprachlicher Dehumanisierung verfällt?
Victor Klemperer hat dies am Beispiel der Lingua Tertii Imperii vorgeführt. Sein "LTI" findet für den Stalinismus ein literarisches Gegenstück in Andrej Platonows 1930 entstandenem Roman "Die Baugrube". Begriffe wie "Klasse", "Linie" oder "Bewusstsein" werden hier zu Gewaltinstrumenten staatlich verordneten Terrors. Wo selbst der Tod, die wohl eigenste, persönlichste Erfahrung überhaupt, kühl "Liquidierung von allem" heißt, ist das individuelle Leiden aus Sprache und Köpfen getilgt. Die Vernichtung ganzer Kontingente von sogenannten "Schädlingen" erscheint nurmehr als notwendige Operation am Volkskörper, der dadurch - so die Hoffnung von Platonows Akteuren - nichts weniger als unsterblich werden soll.
"So gut wie unübersetzbar" hat Joseph Brodsky das Buch genannt, und er fügte hinzu, für die Sprache, in die es sich nicht vermitteln lasse, sei dies womöglich ein Glücksfall. Dennoch wurde die Verdeutschung mehrfach gewagt, nicht zuletzt im Rahmen der bahnbrechenden sechsbändigen Platonow-Edition bei Volk und Welt. Gabriele Leupold hat nun "Die Baugrube" für Suhrkamp neu übertragen, und anders als ihre Vorgänger hat sie die deutsche Sprache nicht geschont. Ein Gewaltakt ist diese Übersetzung und wird gerade deshalb Platonows so großartigem wie verstörendem Roman verblüffend gerecht.
"Die Baugrube" spielt zwischen 1929 und 1930, zur Zeit der forcierten Industrialisierung, die das Sowjetreich binnen kurzem in ein sozialistisches Paradies verwandeln sollte. Der Tscheche Julius Fucík, der die UdSSR damals bereiste, sah ein Land im Geschwindigkeitsrausch, das befeuert von ständigem "Tempo! Tempo!" längst im "Übermorgen" arbeite. Mit diesem Imperativ der Rasanz setzt auch Platonows Roman ein. Der Arbeiter Woschtschew, heißt es im ersten Satz, wird "von der Produktion entfernt infolge . . . seiner Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit".
Woschtschew hat Glück: Die Entlassung ist noch ein mildes Strafmaß für seine Grübelei. Denn die Wahrheit, nach der sich dieser ewige Sinnsucher produktionshemmend verzehrt, steht selbst im Verdacht, ein "Klassenfeind" zu sein. So wird Nachdenken zum Kapitalverbrechen. Dabei ist Woschtschew gar kein Gegner der sozialistischen Utopie - ähnlich wie sein Schöpfer Platonow, der sich in den zwanziger Jahren als Ingenieur bei Großprojekten für den Aufbau des Landes aufrieb. Über der titelgebenden Baugrube, wo der Gefeuerte wieder Arbeit findet, soll ein Gebäude fürs gesamte Proletariat erwachsen: eine Glückskaserne für das zum ewigen Leben erwachte Kollektiv, geführt von Lenin, der im Mausoleum als Mumie seiner Auferstehung harrt.
Der eschatologische Furor, mit dem Woschtschew und seine Genossen den sowjetischen Heilsplan erzwingen wollen, erfasst sämtliche Lebensbereiche und zielt ins Kosmische. In Platonows Roman ist auch noch das Wetter "organisiert", und das Herz schlägt hier "von Gesetz wegen". Bald wird der "ganze Erdball, sein gesamtes Fleisch . . . in exakte, eiserne Hände fallen". Mehr noch als Spaten und Pickel wird aber die Sprache zum Werkzeug für die Schaffung der neuen Welt. An Stelle des göttlichen Alpha und Omega hat die Planbürokratie ihr eigenes Alphabet entwickelt. Die Fibel fürs leseunkundige Proletariat beginnt mit "A" wie "Avantgarde, Aktiv, Akklamateur, Avance, Agitator, Antifaschist", gefolgt von "B" wie "Bolschewik, burshuj, Brigadeboss, beständiger Vorsitzender, der Kolchos beglückt den Besitzlosen, bravo-bravo, Leninisten".
Aus derlei Lettern wird auch der Roman der Zukunft produziert, wie ihn die bald nach dem Entstehen der "Baugrube" formulierte Doktrin des sozialistischen Realismus fordert. Und man ahnt, dass die Lektüre schal sein wird. Platonows Kunstgriff besteht darin, dass er sich dieser Lettern bedient, zugleich aber fremde Buchstaben in den stalinistischen Setzkasten schmuggelt. Solche kalkulierten Störungen im Schriftbild machen den besonderen Reiz seiner Prosa aus. Virtuos gestaltet Platonow die Brüche, wo Realität und Sprache nicht zur Deckung gelangen, die Wirklichkeit hinter dem Plan zurückbleibt. Die Neuübersetzung bildet diese Brüche kongenial nach und fängt auch die Komik ein, die sich aus der oft halb verdauten, agrammatisch zusammengeschraubten Rhetorik ergibt. Manchmal dienen die Propagandafloskeln auch nur der Bemäntelung der unausrottbaren Triebe, wenn sich etwa ein Funktionär seiner Gattin erotisch "anorganisieren" möchte.
Vor allem aber lebt der Roman von der Spannung zwischen offiziellem Aufbaupathos und persönlichem Zweifel, einem Zweifel, der sich nicht selten zur Verzweiflung auswächst. Bisweilen scheint es, als sei die Rage, mit der Platonows Figuren dem Gestein der Baugrube ebenso zu Leibe rücken wie den Kulaken im Nachbardorf, nur eine Art Antidepressivum zur Bekämpfung eines unheilbaren Sinnvakuums. Jede Arbeitspause kann im Nu aus einem Aktivisten einen Hamlet machen. Selbst der Musterarbeiter Tschiklin, bei dem schon der Name (zu Deutsch "Schnipper" oder "Abknaller") kurzen Prozess verheißt, kränkelt an des Gedankens Blässe, kaum lässt er einmal die Hacke sinken. Zwar ist in der Sowjetunion die "Trübsal annulliert", doch weht ein fast schon barock anmutendes Vanitas-Gefühl durch Platonows Baugrube. Der Pessimismus eines Prediger Salomo prallt auf markige Zukunftsparolen. Aus dieser Kollision des Unvereinbaren springt der Funke Poesie, der Platonows Roman zum Meisterwerk macht.
Als die Waise Nastja in der Baugrube Asyl findet, scheint die Schwermut für einen Moment gebannt. Das Mädchen, dessen Name sich vom griechischen Wort für "Auferstehung" herleitet, gehört zu den anrührendsten und furchtbarsten Kindergestalten der Weltliteratur. Die Szene, wie die Tochter einer burshujka der verhungernden Mutter mit einem Zitronenrest über die Lippen fährt, wird man nicht wieder los. In Nastja - die die Zukunftshoffnung, den "Sozialismus im barfüßigen Körper" trägt - liegen die Idiome der alten und neuen Welt zunächst im Widerstreit. Selbst das Ende der eigenen Mutter hinterfragt sie in diesem Sinn: "Mama, warum stirbst du - weil du eine burshujka bist oder vom Tod?" Doch schon wenig später siegt im Kindermund die historische "Notwendigkeit" des Klassenkampfs über die blinde Schicksalswillkür außerhalb des Plans. Mit aller Härte fordert die Kleine die Liquidierung jener Klasse, der sie selbst entstammt.
Platonow liefert eine präzise Illustration zu Hannah Arendts Analyse totalitärer Herrschaft. Die regelrecht asketische Selbstlosigkeit, mit der die Gebrandmarkten im Sowjetstaat das ihnen aufgedrückte Schandmal verinnerlichten und hinnahmen, dass sie den Weg zu räumen hätten - Platonow macht sie gespenstisch anschaulich. Freiwillig legen sich die verfemten Kulaken in den Sarg und harren dort als lebende Tote ihrer Liquidierung. Und selbst ihr Scherge sieht ein, dass auch er noch vor der Ankunft des Sozialismus "als altersmüdes Vorurteil" zugrunde gehen muss. Die Szenen um die Vernichtung der Kulaken gehören zu den eindringlichsten im Roman. Wenn ein Bauer bittet, ihm den hungerdürren Leib mit einem Samowar zu beschweren, wünscht man sich, dass es sich dabei um surreale Überspitzungen handelt. Und wenn schließlich ein Bär, der im Dorf als Schmied arbeitet, den letzten Kulaken den Garaus macht, scheint der Roman vollends ins Phantastische abzudriften. Doch weit gefehlt! Wie der vorzügliche Kommentar zeigt, besitzt jedes noch so bizarre Detail in der "Baugrube" einen realen Kern. Sogar ein schmiedender Bär ist belegt.
Am Ende liegt Nastja im Sterben und verlangt nach ihrer Mama, auch wenn die eine burshujka ist. Mit Nastjas Tod stirbt zugleich die Hoffnung auf eine Auferstehung der leidenden Menschheit im kommunistischen Wohnturm. Platonow hat das Erscheinen seines Romans (1973 in den Vereinigten Staaten, 1987 in der Sowjetunion) nicht mehr erlebt. Er starb 1951, zwei Jahre vor Stalins Tod, in Vergessenheit und Armut. Mit der neuen eindrucksvollen Übertragung der "Baugrube" und Hans Günthers gleichzeitig erschienener kundiger Biographie ist Andrej Platonow endgültig im deutschen Sprachraum angelangt.
BETTINA KAIBACH
Andrej Platonow: "Die Baugrube". Roman.
Aus dem Russischen, mit Kommentaren und einem Nachwort von Gabriele Leupold. Mit einem Essay von Sibylle Lewitscharoff. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 240 S., geb., 24,- [Euro].
Hans Günther: "Andrej Platonow". Biographie. Leben - Werk - Wirkung.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 148 S., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Katharina Granzin findet Andrej Platonows Ende der 20er Jahre entstandenen Roman "Die Baugrube" noch beeindruckender als dessen dystopisches Hauptwerk "Tschewengur". Warum? Weil Platonow sich traut, die sowjetische Gegenwart der späten Zwanziger "tiefschwarz", aber wirklichkeitsgetreu zu schildern und das Geschehen zugleich in "phantasmagorischen", poetischen Bildern voller Drastik so beschreibt, dass es geradezu zeichenhaft "entrückt" erscheint. Gabriele Leupolds Übersetzung, die nicht zuletzt der undurchdringlichen Vielstimmigkeit dieses Romans gerecht wird, ringt der Rezensentin ebenso viel Anerkennung ab wie Leupolds instruktives Nachwort.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Es gab nie einen günstigeren Zeitpunkt, Andrei Platonow neu zu entdecken, als heute.« Ulrich M. Schmid Neue Zürcher Zeitung 20170812