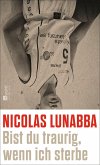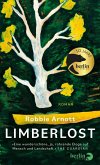Stephan Wackwitz erzählt das Leben seiner Mutter, wie es war und wie es hätte sein können - mit Warmherzigkeit und Einfühlung, mit Intelligenz und Genauigkeit. Hineingeboren in eine schwäbische Industriellenfamilie in Esslingen am Neckar, flieht die 1920 geborene Margot vor dem autoritären Vater ans Berliner Lettehaus, wo sie das Modezeichnen erlernt. Aber trotz frühen künstlerischen Erfolgen und einer Amerikareise gelingt es ihr im Wirtschaftswunder-Deutschland nicht, aus ihrer Begabung mehr zu machen als das Hobby einer Ehefrau und Mutter in der deutschen Provinz. Das 20. Jahrhundert hat Frauen wie ihr alle Möglichkeiten eröffnet - und sofort wieder verschlossen.
Es ist bestechend, wie Wackwitz aus Zeugnissen, zeitgeschichtlichen Reflexionen und Erinnerungen beiläufig ein deutsches Jahrhundert-Panorama entwirft, in dem das Unglück sich weitervererbt. Andrea Köhler Neue Zürcher Zeitung 20151020

Mode, Kunst und Kinder: In seinem Buch "Die Bilder meiner Mutter" ergründet Stephan Wackwitz eine weibliche Biographie in einem Jahrhundert bundesrepublikanischer Enge.
Es gibt wohl kaum einen ergiebigeren Quell für literarische Texte als die eigene Familiengeschichte. Tote Verwandte lassen sich mit etwas Distanz zu lebendigen Romanfiguren ausphantasieren. Ihre nachgelassenen Taschenkalender oder Briefe stoßen Essays zur Zeitgeschichte an, wie etwa in Michael Rutschkys 2012 erschienenem "Merkbuch", das auch von der Kulturtechnik des Notierens handelt.
Eine ähnlich breit gefächerte Auseinandersetzung mit privaten Dokumenten betreibt seit einiger Zeit der Schriftsteller Stephan Wackwitz. 1952 in Stuttgart geboren, leitet er heute das Goethe-Institut in Tiflis. Nach autobiographisch inspirierten Spurensuchen, etwa dem Buch über seinen Großvater väterlicherseits, der 1933 in das ehemalige Deutsch-Südwestafrika auswanderte ("Ein unsichtbares Land", 2003), erzählt er jetzt die Geschichte seiner Mutter. Jahrgang 1920, flieht sie aus dem Schatten eines Nazivaters und der provinziellen schwäbischen Enge in die Großstadt Berlin, wo sie zur Modezeichnerin ausgebildet wird. Erst die Ehe und eigene Kinder schneiden diese Karriere ab.
Dass wir diesem Leben mit wachsendem Interesse folgen, obwohl Wackwitz auf filmisches Erzählen vollkommen verzichtet, liegt nicht zuletzt an der Großzügigkeit, mit der er uns Einblick in Briefe und Tagebücher erlaubt. Da sind beispielsweise die knappen Sätze, die die an Krebs erkrankte Margot Wackwitz in den zwei Jahren vor ihrem Tod 1990 in kleine "Brigitte"-Taschenkalender notiert: "Den ganzen Tag Regen und an dem blauen Rock genäht", oder: "am Namensschild gepinselt", oder: "Ostereier bemalt. Doof. Ich kann gar nichts mehr." Stephan Wackwitz nennt sie "Tagebücher vom Überleben und Sterben", Quellen, aus denen er dosiert zitiert, bis sie von selbst ihren traurigen Kern preisgeben. Seine von Anfang an starke, kommentierende Erzählerstimme verhüllt nicht, dass Wackwitz das Familienmaterial als Betroffener ordnet.
Wichtiger Teil sind dabei die Bilder seiner Mutter: feine, farbige Zeichnungen, die Damen zeigen, die für Mode, Unterwäsche oder Schmuck posieren. Designtrends der Kriegs- und Nachkriegszeit lassen sich daran ablesen. Sie wechseln sich ab mit intimen Porträts Familienangehöriger oder Selbstbildnissen. Nicht alle werden erklärt. So erzählen sie neben dem Text ihre eigene Geschichte und relativieren das vom Sohn Gesagte.
Subtext dieser Lebensschau ist die Psychoanalyse. Stephan Wackwitz hat nicht nur selbst eine dieser "magischen Operationen" hinter sich, sondern favorisiert sie als wichtigen Teil einer zweiten "Zivilisierungsbeschleunigung" in den Achtzigern (nach einer ersten um 1950 herum): als Saat eines allgemeinen, sättigenden Lebenskonstruktivismus, der seiner Mutter nur rudimentär zur Verfügung stand. Im Zuge dieser Analyse schilderte sie ihm Anfang der achtziger Jahre ihre eigene Kindheit in einem langen Brief. Sie erweist sich nicht nur in diesem Dokument selbst als seelentheoretisch gut gerüstet. Etwa, wenn sie erklärt, sie habe als vorlaute, freche "Gasselrandel" für "Wunderglückle" Groschen geklaut, und dann fragend nachsetzt: "Fehlende Liebe?" Gerade in seiner unbehauenen Suchbewegung berührt dieses Zeugnis der Mutter, die sich an Verständnis und Distanz zum "ehrenwerten deutschen Familienvater" versucht.
Das mütterliche "Kinderunglück in der Nazifamilie" führt Wackwitz zu seinem Großvater Ernst Hartmetz. 1932 eingetreten in die NSDAP, kümmerte er sich unter anderem als Blockwart um die Durchsetzung der Nazidoktrin und saß nach Kriegsende ein halbes Jahr im Lager. Er wirft seinen Schatten noch weit über das Leben der Mutter hinaus. Der Sechzehnjährigen verhalf die rettende Zeichenbegabung 1936 zur kurzfristigen Flucht aus dem schwäbisch-autoritären Kleinmief: Am Berliner Lette-Institut - hier wurde bereits in den zwanziger Jahren "neue Weiblichkeit" gelehrt - erhielt sie eine solide, kunsthandwerkliche Fachausbildung. Hier lernte sie auch, wie man mit Geld umgeht. Die Rückkehr ins Elternhaus mit neunzehn als Angestellte einer Stuttgarter Werbeagentur sicherte ihr ein wenig Unabhängigkeit. Irgendwann aber machten die Ausbrüche des Vaters ein Zusammenleben unmöglich. Wie es in der folgenden Ehe mit Stephan Wackwitz' Vater, einem Dolmetscher-Lehrer und Goethe-Institutsleiter, weitergeht, verrät eine Morgenstern-Gedichtausgabe aus Familienbesitz: Von Margot Wackwitz expressiv-ausgreifend illustriert, ging sie derart aufgewertet an den Gatten als Geschenk zurück. Das Kapital "Zeichnen", schließt Wackwitz, hatte mit der Stelle des Vaters und Umzügen nach Iserlohn und Blaubeuren seine Geschäftsgrundlage verloren.
Die Zumutung, die sich aus dem erstickten Talent-Traum für die Mutter ergibt, vermittelt sich nicht nur durch den durchgehend empathischen Tonfall, sondern auch durch Wackwitz' essayistische Verfugung. Innerfamiliäre Gaben wie die Morgenstern-Ausgabe - oder aus dem schlechten Muttergewissen heraus "Bambi" an den Sohn - werden einem als "literarische Kassiber" vorgestellt, als Beziehungsbotschaften: Worüber nicht gesprochen wird, das verschiebt sich in Geschenke. Wohl wahr. Dass in den fünfziger Jahren immer noch Erziehungsratgeber von 1934 im Einsatz sind, ist Wackwitz ein Kapitel wert. Ein anderes beschäftigt sich mit den weiblichen Flakhelfern, mit den unzähligen Frauen und Teenagern, die als militärisches Hilfspersonal reguläre Soldaten ersetzten und die man unter diesem Begriff oft genug unterschlägt. Margot Wackwitz wurde 1944 zur Meldefahrt abgeordert, der Zug beschossen. Lange trägt sie an Verletzungen. Wie eine Kinderzeichnung wirkt ein Krankenhausbild, das sie mit links malen muss: ein Mädchen im Bett sitzend vor sonnenbuntem Fenster. Darüber in Sütterlin der Satz: "Dort möchte ich sein!" Solche Fundstücke sind auch für den Leser intime Verweilstationen auf Wackwitz' Reise durch die Familiengeschichte.
Freilich muten manche Interpretationen wie die notwendige Familienrhetorik des wohlmeinenden, narzisstisch sich selbst beäugenden Sohnes an. Etwa wenn er anfangs anhebt, es folge eine weibliche Heroismusgeschichte, mit den dazu offenbar obligatorischen Eckdaten Mode, Kunst und Kinder. Braucht es diese Aufwertung? Oder schafft sie nicht erst die Gefahr der Unterbewertung, die sie beheben will? Auch ein "Künstlerroman" ist die Geschichte der Mutter nicht. Aber es ist verführerisch, solchen von Stephan Wackwitz gezogenen Linien nachzuspüren: Margot Wackwitz, eine verzweifelte Romanfigur wie bei Richard Yates?
Skurril und eine selten gehörte Nebenanekdote nachkriegsgeprägten Reinemachens ist die Erwähnung des Großvaters im amerikanischen Mormonenarchiv der Zentrale in Salt Lake City. Hier hinein schafft es jeder, der von überzeugten Mormonen zum Zwecke der nachträglichen "Totentaufe" benannt wird. Kurios ist nicht nur dieses riesige genealogische Archiv, sondern die Tatsache, dass nach Kriegsende amerikanische Verwandte beim ehemaligen Nazi-Blockwart auftauchten, sich auf ihre deutschen Wurzeln besannen und freundlich aufgenommen wurden. Im Gegenzug schickten sie der Familie fast dreihundert Lebensmittelpakete und luden die Mutter zu Reisen ein.
Diese erstaunliche Nebengeschichte erzählt mehr über die inkonsequent durchgeführte amerikanische Entnazifizierungs-Farce als ein faktenstarkes Geschichtsbuch. Genau das nämlich ist "Die Bilder meiner Mutter" nicht. Denn alles kommt unter den ebenso sozialkritisch wie psychologisch bewusst geschärften Erzählerblick. Selbst Orte wie die Stadt Esslingen, die Wiege der Wackwitze, sind dem Autor suspekt mit ihrem "massiv Psychopathischen". Dieser zupackende, nichts verharmlosende, einlassende Erzählstil macht Spaß. Wackwitz ordnet dabei nicht nur Lebensläufe, sondern ein Jahrhundert bundesrepublikanischer Enge und Paradigmenwechsel. Sich selbst spart er dabei keineswegs aus. Der Einzelfall erklärt hier im besten Sinne das Allgemeine und lässt trotzdem Fragen zu. Hut ab vor einem so genau inspizierenden, in- wie aushäusigen Blick.
ANJA HIRSCH
Stephan Wackwitz: "Die Bilder meiner Mutter".
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2015. 233 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Zunächst einmal listet Rezensentin Ursula März ein paar Autoren und Werke auf, die ihrer Meinung nach ein neues Genre begründen: Verteidigungsschriften von Söhnen über ihre Eltern. Neben Botho Strauss, Ralf Rothmann und Peter Schneider nun also auch Stephan Wackwitz, der mit "Die Bilder meiner Mutter" ein so stilistisch wie auch inhaltlich herausragendes Buch geschrieben hat, meint März. So liest sie angetan die Erzählung um Margot Wackwitz, die von einer Künstler-Karriere träumte, sich aber schließlich den Ehe- und Alltagspflichten im Nachkriegsdeutschland beugte. Gelegentlich gerät der Kritikerin das Buch ein wenig zu überladen mit psychoanalytischen, philosophischen, historischen oder literarischen Exkursen, die das Porträt der Mutter erdrücken. Dennoch kann sie dieses mit wunderbaren Porträtskizzen und Modeillustrationen der Mutter angereicherte Werk unbedingt empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH