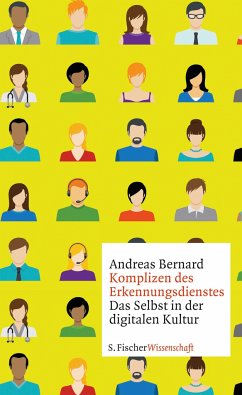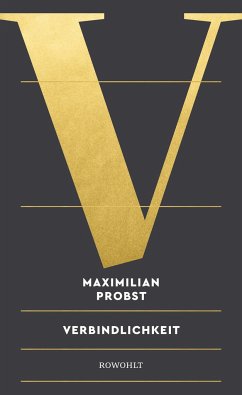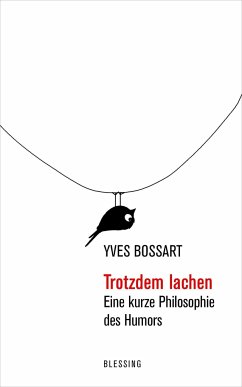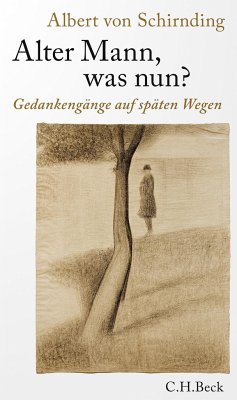Nicht lieferbar

Die blitzenden Waffen (Mängelexemplar)
Über die Macht der Form
Ein ebenso glänzender wie scharfsinniger Beitrag zur jahrtausendealten Debatte über Wesen und Form, Essenz und Oberfläche, Argument und RhetorikWarum lieben wir bestimmte Autos - und oft nicht die nützlichsten? Warum berührt uns ein bestimmtes Kunstwerk, während andere uns kalt lassen? In welchen Worten muss ein guter Ratschlag formuliert sein, damit er beim Gegenüber Wirkung zeigt? In seinem neuen Buch untersucht der Philosoph Robert Pfaller Funktion, Bedingung und Wirkungsweise der Form, um ihrem Geheimnis auf die Spur zur kommen - ihrer Macht.Schon Quintilian wusste: »Ein Redner mus...
Ein ebenso glänzender wie scharfsinniger Beitrag zur jahrtausendealten Debatte über Wesen und Form, Essenz und Oberfläche, Argument und Rhetorik
Warum lieben wir bestimmte Autos - und oft nicht die nützlichsten? Warum berührt uns ein bestimmtes Kunstwerk, während andere uns kalt lassen? In welchen Worten muss ein guter Ratschlag formuliert sein, damit er beim Gegenüber Wirkung zeigt? In seinem neuen Buch untersucht der Philosoph Robert Pfaller Funktion, Bedingung und Wirkungsweise der Form, um ihrem Geheimnis auf die Spur zur kommen - ihrer Macht.
Schon Quintilian wusste: »Ein Redner muss nicht nur mit scharfen Waffen kämpfen, sondern auch mit blitzenden.« Robert Pfaller geht einen Schritt weiter: Er erklärt, warum überhaupt nur blitzende Waffen scharf sein können.
Der Bestseller-Autor von »Erwachsenensprache« und »Wofür es sich zu leben lohnt« räumt auf mit unserer Vorstellung, wir würden uns von Oberflächen nicht täuschen lassen und direkt in die Tiefe der Dinge blicken. Stattdessen postuliert Robert Pfaller ein sehr viel komplexeres Beziehungsgefüge: die Dialektik von Form und Inhalt.
Warum lieben wir bestimmte Autos - und oft nicht die nützlichsten? Warum berührt uns ein bestimmtes Kunstwerk, während andere uns kalt lassen? In welchen Worten muss ein guter Ratschlag formuliert sein, damit er beim Gegenüber Wirkung zeigt? In seinem neuen Buch untersucht der Philosoph Robert Pfaller Funktion, Bedingung und Wirkungsweise der Form, um ihrem Geheimnis auf die Spur zur kommen - ihrer Macht.
Schon Quintilian wusste: »Ein Redner muss nicht nur mit scharfen Waffen kämpfen, sondern auch mit blitzenden.« Robert Pfaller geht einen Schritt weiter: Er erklärt, warum überhaupt nur blitzende Waffen scharf sein können.
Der Bestseller-Autor von »Erwachsenensprache« und »Wofür es sich zu leben lohnt« räumt auf mit unserer Vorstellung, wir würden uns von Oberflächen nicht täuschen lassen und direkt in die Tiefe der Dinge blicken. Stattdessen postuliert Robert Pfaller ein sehr viel komplexeres Beziehungsgefüge: die Dialektik von Form und Inhalt.