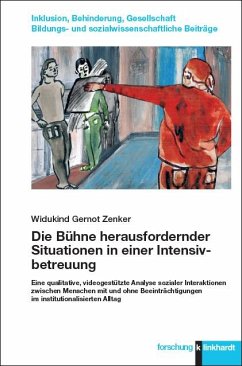Widukind Gernot Zenker
Die Bühne herausfordernder Situationen in einer Intensivbetreuung
Eine qualitative, videogestützte Analyse sozialer Interaktionen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen im institutionalisierten Alltag
Widukind Gernot Zenker
Die Bühne herausfordernder Situationen in einer Intensivbetreuung
Eine qualitative, videogestützte Analyse sozialer Interaktionen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen im institutionalisierten Alltag
- Broschiertes Buch
- Merkliste
- Auf die Merkliste
- Bewerten Bewerten
- Teilen
- Produkt teilen
- Produkterinnerung
- Produkterinnerung
In einer Intensivbetreuung finden soziale Interaktionen zwischen Begleitpersonal und erwachsenen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in einem eng strukturierten Alltag statt. Die Bühne der herausfordernden Situationen hat ihre Ursachen in einer oft unzureichend realisierten kommunikativen Teilhabe und im permanenten, institutionellen Zugriff auf alle Lebensbereiche. Herausfordernde Situationen haben Kommunikationsgehalt und ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe, sie sind für die Institution problematisch und legitimieren gleichzeitig die Intensivbetreuung als Sondersetting.…mehr
Andere Kunden interessierten sich auch für
![Ent-hinderung Ent-hinderung]() Simone DanzEnt-hinderung30,00 €
Simone DanzEnt-hinderung30,00 €![Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Ermöglichung von Teilhabe Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Ermöglichung von Teilhabe]() Norbert PeichlLebensweltorientierte Soziale Arbeit als Ermöglichung von Teilhabe78,00 €
Norbert PeichlLebensweltorientierte Soziale Arbeit als Ermöglichung von Teilhabe78,00 €![Heilpädagogik Heilpädagogik]() Heidi FischerHeilpädagogik27,00 €
Heidi FischerHeilpädagogik27,00 €![Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer Unterstützung Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer Unterstützung]() Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer Unterstützung34,95 €
Begleitete Elternschaft in den Spannungsfeldern pädagogischer Unterstützung34,95 €![Disability Studies und Soziale Arbeit Disability Studies und Soziale Arbeit]() Lars BruhnDisability Studies und Soziale Arbeit28,00 €
Lars BruhnDisability Studies und Soziale Arbeit28,00 €![Theorie und Praxis der Heilerziehungspflege Theorie und Praxis der Heilerziehungspflege]() Wolfram KuligTheorie und Praxis der Heilerziehungspflege27,00 €
Wolfram KuligTheorie und Praxis der Heilerziehungspflege27,00 €![Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe]() Viola HarnachPsychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe29,95 €
Viola HarnachPsychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe29,95 €-
-
-
In einer Intensivbetreuung finden soziale Interaktionen zwischen Begleitpersonal und erwachsenen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in einem eng strukturierten Alltag statt. Die Bühne der herausfordernden Situationen hat ihre Ursachen in einer oft unzureichend realisierten kommunikativen Teilhabe und im permanenten, institutionellen Zugriff auf alle Lebensbereiche. Herausfordernde Situationen haben Kommunikationsgehalt und ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe, sie sind für die Institution problematisch und legitimieren gleichzeitig die Intensivbetreuung als Sondersetting. Kommunikationsbühnen einer Intensivwohngruppe werden über videogestützte Analysen anschaulich nachgezeichnet. Die Perspektiven für die sozial- und sonderpädagogische Praxis geben Inspiration für mehr kommunikative Teilhabe und für die Reduktion des institutionellen Zugriffs auf Menschen mit Beeinträchtigungen.
Produktdetails
- Produktdetails
- klinkhardt forschung. Inklusion, Behinderung, Gesellschaft. Bildungs- und sozialwissenschaftliche Beitr
- Verlag: Klinkhardt
- Seitenzahl: 276
- Erscheinungstermin: 15. Februar 2023
- Deutsch
- Abmessung: 233mm x 162mm x 17mm
- Gewicht: 454g
- ISBN-13: 9783781525535
- ISBN-10: 3781525538
- Artikelnr.: 67388540
- Herstellerkennzeichnung
- Klinkhardt, Julius
- Ramsauer Weg 5
- 83670 Bad Heilbrunn
- +4980469304
- klinkhardt forschung. Inklusion, Behinderung, Gesellschaft. Bildungs- und sozialwissenschaftliche Beitr
- Verlag: Klinkhardt
- Seitenzahl: 276
- Erscheinungstermin: 15. Februar 2023
- Deutsch
- Abmessung: 233mm x 162mm x 17mm
- Gewicht: 454g
- ISBN-13: 9783781525535
- ISBN-10: 3781525538
- Artikelnr.: 67388540
- Herstellerkennzeichnung
- Klinkhardt, Julius
- Ramsauer Weg 5
- 83670 Bad Heilbrunn
- +4980469304
Widukind Gernot Zenker - Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaft (MA, Universität Leipzig), Weiterqualifikation in der Sozialen Arbeit (BA, EvH Bochum), Sozialpädagoge. 2016 bis 2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Luzern im Themenbereich Beeinträchtigung. Seit 2018 Dozent an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik Luzern (hsl). Seit 2017 Doktoratsstudium am Lehrstuhl Sonderpädagogik: Gesellschaft, Partizipation und Behinderung, am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich, Promotion (Dr. phil.) im Juni 2022.
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Interaktionen im Spannungsfeld Mensch - Institution, einleitende Gedanken . . . . 171.1 Reflexionen darüber, was ein Dissertationstext abzubilden vermag . . . . . . . . . . . . 171.2 Überlegungen zur qualitativen Erhebung in einem Interaktionssystem iminstitutionellen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.3 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4 Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.5 Forschungsfragen und Zielsetzungen des Dissertationsprojektes . . . . . . . . . . . . . . 311.5.1 Forschungsfragen und Wege zu diesen. Einblicke in den Prozessdes Fragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.5.2 Zielsetzungen im Spannungsfeld Grounded Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.6 Das Forschungsdesign: Eine qualitative Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.7 Inhaltliche Eingrenzung und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.8 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Methodisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.1 Fokussierte Ethnografie, Kommunikativer Konstruktivismus undKommunikation als Handeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.2 Videografie und videogestützte Interaktionsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.2.1 Videogestützte Methoden im Kontext Behinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.2.2 Reaktanz und Akzeptanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582.2.3 Kameraperspektiven und Möglichkeiten der Kamerabrille . . . . . . . . . . . . . 612.3 Ethische Aspekte des Forschens in menschlichen Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . 642.3.1 Briefing und Debriefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.4 Chancen und Begrenzungen der gewählten Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Theoretische Versatzstücke zur Konstruktion einer nachvollziehbarenBeschreibung von Interaktionen in sozialen Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773.1 Grounded Theory als Haltung: Prozess, Passung und Anschlussfähigkeit . . . . . . 783.1.1 Theoriegeleitetes Arbeiten und theoriegenerierender Prozess . . . . . . . . . . 803.1.2 ANT und Grounded Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.1.3 Komplexität und Dichte von Theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.1.4 Bisherige Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit, eine Überleitung . . . . 853.2 Menschen als Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.3 Soziale Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.3.1 Soziale Systeme nach Luhmann: Gedanken zur Anwendbarkeit fürBeobachtungen und Beschreibungen von Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . . 883.3.2 Interaktionen und Interaktionssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943.3.3 Beobachtbare und beschreibbare Systemeinheiten, Gedanken zumKommunikations- und Interaktionsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.3.4 Handlungen als Einheiten sozialer Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003.3.5 Pulsierende Kommunikationssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.3.6 Kommunikation, codierte Ereignisse und Rauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023.4 Gedanken zu Interaktionsrahmen, inspiriert von Schütz und Luckmann . . . . . . 1053.5 Goffmans Redeweisen im Kontext institutionell organisierter Begleitungvon Menschen mit Beeinträchtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.5.1 Elemente und Struktur von Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.5.2 Rollen, Ensembles und ihre Bühnen in sozialen Situationen . . . . . . . . . . . 1083.6 Körper in herausfordernden Situationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133.7 Systemtheoretische Sichtweisen in sozial- und sonderpädagogischerAnwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Menschen mit Beeinträchtigungen im Kontext Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.1 Von Sichtweisen auf kognitive Behinderung zu Sichtweisen kognitiverDiversität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.2 Institutionen und Individuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254.2.1 Intensivbetreuung als Beispiel eines Sondersettings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264.2.2 Goffmans Gedanken zur Totalen Institution - Möglichkeitenund Grenzen einer Anwendung auf die heutige Situation . . . . . . . . . . . . . . 1395 Interaktion und Kommunikation in Settings der Intensivbetreuung . . . . . . . . . . . . . 1475.1 Intensivbetreuung im Spannungsfeld Wohnen,Bewohner*innenperspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475.2 Kommunikationsbühnen und ihre Ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495.2.1 Inszenierungen in der Intensivbetreuung, einleitende Worte . . . . . . . . . . . 1495.2.2 Hauptbühnen in einem komplexen System: Bewohner*innen undFachpersonen im institutionalisierten Alltag und in herausforderndenSituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2.3 Eintritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905.2.4 Kontraste der Ensembles und Hypothesen zur Annäherungan eine gelingende Kommunikationskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925.3 Typische Interaktionsmuster, eine Draufsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945.4 Hypothesen zum sozialen System einer Intensivbetreuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955.5 Phänomene und offene Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Diskussion der Ergebnisse und Reflexion der Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976.1 Erkenntnisse zur Beschreibung und Gestalt eines sozialen Systems undseiner Subsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976.2 Intensivbetreuung als Begriff der sozialpädagogischen Praxis,Erkenntnisse und Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006.3 Methodologische Erkenntnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036.4 Anschlussfähigkeit der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046.4.1 Zehn Perspektiven für die sozial- und sonderpädagogische Praxis . . . . . . 2046.4.2 Perspektiven für weitere Forschung in sozial- undsonderpädagogischen Kontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096.5 Schlusswort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Interaktionen im Spannungsfeld Mensch - Institution, einleitende Gedanken . . . . 171.1 Reflexionen darüber, was ein Dissertationstext abzubilden vermag . . . . . . . . . . . . 171.2 Überlegungen zur qualitativen Erhebung in einem Interaktionssystem iminstitutionellen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.3 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4 Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.5 Forschungsfragen und Zielsetzungen des Dissertationsprojektes . . . . . . . . . . . . . . 311.5.1 Forschungsfragen und Wege zu diesen. Einblicke in den Prozessdes Fragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.5.2 Zielsetzungen im Spannungsfeld Grounded Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.6 Das Forschungsdesign: Eine qualitative Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.7 Inhaltliche Eingrenzung und Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.8 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Methodisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.1 Fokussierte Ethnografie, Kommunikativer Konstruktivismus undKommunikation als Handeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.2 Videografie und videogestützte Interaktionsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.2.1 Videogestützte Methoden im Kontext Behinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.2.2 Reaktanz und Akzeptanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582.2.3 Kameraperspektiven und Möglichkeiten der Kamerabrille . . . . . . . . . . . . . 612.3 Ethische Aspekte des Forschens in menschlichen Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . 642.3.1 Briefing und Debriefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.4 Chancen und Begrenzungen der gewählten Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Theoretische Versatzstücke zur Konstruktion einer nachvollziehbarenBeschreibung von Interaktionen in sozialen Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773.1 Grounded Theory als Haltung: Prozess, Passung und Anschlussfähigkeit . . . . . . 783.1.1 Theoriegeleitetes Arbeiten und theoriegenerierender Prozess . . . . . . . . . . 803.1.2 ANT und Grounded Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.1.3 Komplexität und Dichte von Theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.1.4 Bisherige Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit, eine Überleitung . . . . 853.2 Menschen als Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.3 Soziale Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.3.1 Soziale Systeme nach Luhmann: Gedanken zur Anwendbarkeit fürBeobachtungen und Beschreibungen von Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . . 883.3.2 Interaktionen und Interaktionssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943.3.3 Beobachtbare und beschreibbare Systemeinheiten, Gedanken zumKommunikations- und Interaktionsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.3.4 Handlungen als Einheiten sozialer Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003.3.5 Pulsierende Kommunikationssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.3.6 Kommunikation, codierte Ereignisse und Rauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023.4 Gedanken zu Interaktionsrahmen, inspiriert von Schütz und Luckmann . . . . . . 1053.5 Goffmans Redeweisen im Kontext institutionell organisierter Begleitungvon Menschen mit Beeinträchtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.5.1 Elemente und Struktur von Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.5.2 Rollen, Ensembles und ihre Bühnen in sozialen Situationen . . . . . . . . . . . 1083.6 Körper in herausfordernden Situationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133.7 Systemtheoretische Sichtweisen in sozial- und sonderpädagogischerAnwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Menschen mit Beeinträchtigungen im Kontext Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.1 Von Sichtweisen auf kognitive Behinderung zu Sichtweisen kognitiverDiversität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.2 Institutionen und Individuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254.2.1 Intensivbetreuung als Beispiel eines Sondersettings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264.2.2 Goffmans Gedanken zur Totalen Institution - Möglichkeitenund Grenzen einer Anwendung auf die heutige Situation . . . . . . . . . . . . . . 1395 Interaktion und Kommunikation in Settings der Intensivbetreuung . . . . . . . . . . . . . 1475.1 Intensivbetreuung im Spannungsfeld Wohnen,Bewohner*innenperspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475.2 Kommunikationsbühnen und ihre Ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495.2.1 Inszenierungen in der Intensivbetreuung, einleitende Worte . . . . . . . . . . . 1495.2.2 Hauptbühnen in einem komplexen System: Bewohner*innen undFachpersonen im institutionalisierten Alltag und in herausforderndenSituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2.3 Eintritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905.2.4 Kontraste der Ensembles und Hypothesen zur Annäherungan eine gelingende Kommunikationskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925.3 Typische Interaktionsmuster, eine Draufsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945.4 Hypothesen zum sozialen System einer Intensivbetreuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955.5 Phänomene und offene Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Diskussion der Ergebnisse und Reflexion der Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976.1 Erkenntnisse zur Beschreibung und Gestalt eines sozialen Systems undseiner Subsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976.2 Intensivbetreuung als Begriff der sozialpädagogischen Praxis,Erkenntnisse und Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006.3 Methodologische Erkenntnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036.4 Anschlussfähigkeit der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046.4.1 Zehn Perspektiven für die sozial- und sonderpädagogische Praxis . . . . . . 2046.4.2 Perspektiven für weitere Forschung in sozial- undsonderpädagogischen Kontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096.5 Schlusswort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213