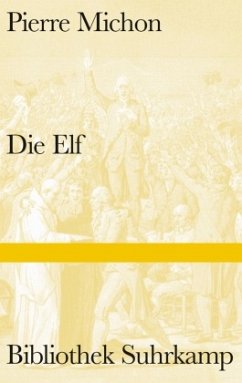Pierre Michon ist einer der bedeutendsten französischen Gegenwartsschriftsteller. Im Mittelpunkt seiner neuen Erzählung »Die Elf«, einer meisterhaft vertrackten historischer Novelle, steht das berühmteste Gemälde der Französischen Revolution, das im Louvre hinter Panzerglas hängt und elf Direktoriumsmitglieder im Jahr II der Schreckensherrschaft porträtiert. Michon erzählt von dem Maler und dessen Familiengeschichte, von den elf Porträtierten und davon, wie und warum der Künstler den Auftrag zu diesem Bild erhielt - evozierend, akribisch, mit essayistischen Bemerkungen und Ausführungen. Dieses besondere Bild, »Die Elf«, schreibt Michon, bilde Geschichte nicht ab, sondern »sei« Geschichte, ihr Schrecken. Seine ebenso knappe wie virtuose Erzählung baut eine ganz eigene Spannung auf und hält sie, bis zum überraschenden Schluß.

François-Elie Corentin war der größte Maler der Französischen Revolution. Und das, obwohl er nie existiert hat, wie Pierre Michon beweist.
Von Lena Bopp
Am Ende möchte man augenblicklich in den Louvre gehen, und zwar genau so, wie Pierre Michon es in seinem neuen Buch beschreibt: "Pfeilschnell an der Mona Lisa vorbei, die lediglich eine verträumte Frau ist", vorbei an Paolo Uccellos Schlachtengemälde, "vorbei am roten Gespenst des von Champaigne gemalten Kardinalherzogs, vorbei an sechsunddreißigmal Louis le Grand unter seiner monströsen Perücke", und hin zu dem Bild, auf das hier alles hinausläuft: Die Elf, gemalt von François-Elie Corentin. Sie wissen schon, dem Corentin.
Sie wissen es nicht? Macht nichts, denn Sie können es gar nicht wissen. Corentin ist eine Erfindung, genauso wie das Gemälde, dem die nun auf Deutsch erschienene Novelle von Pierre Michon ihren Titel verdankt: "Die Elf". Das großformatige Bild ist ein reines Phantasieprodukt, aber ein so gut gemachtes, dass man ihm erst allmählich auf die Schliche kommt. Michons Buch ist ein Vexierspiel, als dessen Strippenzieher ein manipulativer Erzähler fungiert, der den Leser wie ein Museumsführer durch die Geschichte begleitet, seine Blicke lenkt und seine Naivität tadelt, nur um ihm gleich darauf wieder einen Bären aufzubinden. Er gibt es selbst zu: "Vor diesem so unwahrscheinlichen Bild, das alles besaß, um nicht zu existieren, das durchaus auch nicht hätte existieren können, dürfen, so dass man, wenn man davorsteht, zu zittern beginnt bei dem Gedanken, dass es beinahe nicht existiert hätte, vor ihm ermisst man die ungemeine Chance der Geschichte."
Es ist eine Geschichte, die ein Produkt des Zufalls ist und nicht der Vorsehung. Bei Michon hat es der Zufall gewollt, dass er sich über fünfzehn Jahre mit der Französischen Revolution und vor allem der Schreckensherrschaft beschäftigte, also mit jener Zeit 1793/94, in der die Jakobiner um Robespierre den Wohlfahrtsausschuss in ihre Gewalt brachten und in das Exekutivorgan ihrer Diktatur verwandelten - in seinem Buch bezeichnet Michon diese Zeit als "Höhepunkt der Geschichte". Eine gute Zeit für Legenden war die Periode der Terreur allemal, und eine solche Legende hat nun eben auch Michon gesponnen. Sie hat keine Vorläufer in der Geschichte und ist doch so gestrickt, dass man sie ohne weiteres für bare Münze nimmt. Warum soll es nicht so gewesen sein?
In Combreux, einem Kaff an der Loire, unweit von Orléans, erblickt François-Elie Corentin im Jahr 1730 das Licht der Welt. Er ist der Sohn eines aus dem Limousin stammenden ehemaligen Arbeitssklaven, wie sie damals zu Hunderten aus der Region an die reichere Loire gekommen waren, und einer einigermaßen wohlhabenden, ängstlichen Mutter. Das Geld der Familie bringt er in Paris durch, wo ihn sein Talent bis in die Werkstätten des großen Historienmalers Louis David führt. Corentin wird sein Schüler. Später wird er zu jener Handvoll von Künstlern gehören, die "aus unerfindlichen Gründen von der Menge auserwählt wurden und in die Legende sprangen, während die anderen am Ufer zurückblieben, einfach Maler - sie aber sind mehr als Maler, Giotto, Leonardo, Rembrandt, Corentin, Goya, Vincent van Gogh". Später, eines Tages, oder vielmehr: eines Nachts wird er von drei Mitgliedern des Wohlfahrtsausschusses aus dem Schlaf gerissen und mit einer geheimen Aufgabe betraut. Er soll die elf Mitglieder des Gremiums auf einem Bild verewigen. Robespierre und seine Verbündeten sollen in der Mitte stehen, aber so, dass zwei Sichtweisen möglich sind: eine vergötternde, die dem Herrscher Robespierre huldigt, und eine sezierende, die ihn als machthungrigen Tyrannen denunziert - "je nachdem, welche der beiden Lesarten die Fakten erforderten". Denn noch weiß niemand, in welche Richtung das Pendel der Geschichte ausschlagen wird, wer also am Ende als Sieger vom Platz geht. So entsteht das berühmteste Gemälde der Welt, es ähnelt einem "weltlichen Abendmahl".
Michon, dessen Erzähler den Leser immer wieder direkt anspricht ("Sehen Sie sie, Monsieur?", "Ich bitte Sie, Monsieur, Ihr Augenmerk auf Folgendes zu richten"), verwebt in seinem Text historisch Verbürgtes und frei Erfundenes so eng, dass eine Unterscheidung nicht nur schwerfällt, sondern auch nicht opportun erscheint. Der Text trägt seine Mehrdeutigkeit vor sich her wie eine Monstranz. Zuweilen schimmern vertraute Motive aus dem bisherigen Werk Michons durch, etwa dort, wo es um Corentins limousinische Wurzeln geht (Michon selbst stammt aus dem Limousin), um das harte Leben der einfachen Leute in der Provinz (von dem er unter anderem in "Die Grande Beune" erzählt hat), und auch um ihre Sehnsucht nach einem Aufstieg durch Bildung (was im "Leben der kleinen Toten" eine Rolle spielt). Auch hat sich Pierre Michon bereits mit einigen bedeutenden Figuren der Historie befasst, etwa mit dem Maler Goya (in "Herr und Diener") und dem Dichter Rimbaud (in "Rimbaud der Sohn").
Nun aber weitet er seinen Umgang mit der Geschichte und erschafft eine Figur aus dem Nichts, die, eben weil sie in ihren Abhängigkeiten und ihrem Schicksal so überaus nachvollziehbar ist, unser Verhältnis zu dieser Geschichte selbst in Frage stellt. Wer macht eigentlich Geschichte? Der große französische Historiker Jules Michelet, dem Michon frech unterstellt, in seinen Wälzern über die Revolution zwölf Seiten jenem Gemälde und seiner Entstehung gewidmet zu haben? Sind es die vielen Biographen, deren Bücher Michons Erzähler studiert, um uns Lesern den Maler Corentin näherzubringen? Oder ist es am Ende einfach der Dichter, dessen Gabe größer ist als die aller anderen, weil er es als Einziger versteht, Geschichte tatsächlich zu schreiben? Die Antwort liegt auf der Hand.
Sie ist aber nicht, wie es nun vielleicht den Anschein haben mag, aus dem Hochmut eines guten Schriftstellers geboren, sondern entsteht aus einem Spiel der Kräfte, das Michon einfach freier zu inszenieren versteht als andere. Sie ist in jenem düsteren, immer wieder von Ironie und zuweilen von Sarkasmus durchsetzten Ton formuliert, der Pierre Michons Bücher auszeichnet und hier auch als Hinweis auf die heikle Allmacht des Erzählers zu lesen ist. "Die Elf", heißt es einmal, "ist keine Historienmalerei, es ist die Historie selbst." Das gilt für beides, für das Gemälde und das Buch. Es ist Geschichte, ins Bild gesetzt, und zwar so gut, dass man sie beim Lesen vor dem inneren Auge deutlich sehen kann.
Pierre Michon: "Die Elf".
Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Bibliothek Suhrkamp, Berlin 2013. 120 S., geb., 17,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Pierre Michons Büchlein "Die Elf" hat Andreas Isenschmid fasziniert, in singenden Wortkaskaden spricht es "durch Malerei über Malerei", erklärt der Rezensent. Michon erzählt die Geschichte eines fiktiven Malers, François-Élie Corentin, und seines berühmtesten Gemäldes, "Die Elf", auf dem die elf Kommissare des Wohlfahrtsausschusses zu sehen sind, in der Mitte Robbespierre, berichtet Isenschmid. Zunächst wirkt es, als wolle Michon so etwas wie geschichtsphilosophische Thesen aufstellen, aber die wirft er selbst umgehend wieder über den Haufen und löst sie in langen Assoziationsketten durch die Kunstgeschichte auf, erklärt der Rezensent. Der rasante Wechsel zwischen Fakt und Fiktion ist Michon laut Isenschmid meisterlich gelungen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Michon ... hat in den Elf erstmals fast romanesk erfunden. Wie er dabei die Fakten der Revolution mit seiner Fiktion verschränkt, ist meisterlich.« Andreas Isenschmid DIE ZEIT 20140123