Großeltern sind, die das Leben ihrer Kinder und Enkelkinder bis vor kurzem begleitet und geprägt haben. Dass die Autorin als junge Jüdin, sie kam 1981 in Frankfurt zur Welt, einen großen Teil ihres Lebens mit Verwandten verbracht hat, die derartig traumatisiert waren, dass ihre Kraft kaum noch zum Leben reichte. Die Juristin hat zwar mit ihrem Erstlingswerk ein autographisches Buch geschrieben, in dem sie ihr Leben als Angehörige der dritten Generation nach der Schoa beschreibt. "Die Enkelin" ist dennoch ein sehr literarisches Werk, es ist umgangssprachliches Protokoll einer merkwürdigen Kindheit und Liebeserklärung an die verwundete Familie.
Trzebiner erzählt von ihrem Großvater Avraham, der nirgends bleiben kann, der zwischen Deutschland und Israel hin- und herzieht, wobei er von Letzterem meint, es sei nur zum Wäschetrocknen gut, und sich Kaffee und Nivea-Seife nachliefern lässt. Der die Familienhündin mal schlägt, mal im Restaurant mit am Tisch sitzen lässt und mit der Gabel füttert. Trzebiner erzählt von Urlauben in Israel, von ihrem nichtjüdischen Freund und vom Schweigen am Abend des Schabbats. Bemerkenswert an diesem Debüt ist, dass Trzebinerseinfache, trockene Stimme literarisch stark genug ist, das Erzählte zu tragen, und damit dem Leiden ihrer Großeltern zu dem Raum verhilft, den es in einem solchen Buch haben kann.
Das macht sie stilistisch viel überzeugender als etwa die israelische Autorin Lizzie Doron, die als Kind einer Überlebenden zuletzt in "Das Schweigen meiner Mutter" einen ähnlichen Tonfall von Wahrhaftigkeit zu erzeugen suchte. Vor allem aber ist Trzebiner, gerade auch da, wo sie komisch ist, sehr stark darin, ein Lebensgefühl zu vermitteln, bei dem das Jüdischsein gleichsam der Grundton ist, aus dem die Stimmung des Buchs ersteht. Sie benennt einfach, erzählt von ihrer liebevollen, hilflosen Mutter, vom frühverstorbenen Vater, von der älteren Schwester, für die sie, die jüngere, das Tor zum Leben aus der Familienstille war. Auch die Komik entsteht aus der schlichten Form des Aufzählens von Alltagssituationen: Der Großvater lockt die kleine Channah frühmorgens zum Einkaufen auf den Markt, indem er ihr ein Einhorn verspricht. Als die Kleine ständig fragt, wo das Einhorn denn nun sei, sagt Avraham: "Channale, di weist, wus is a polizei?" Sie entgegnet: "Jo, Opa." Und der Großvater: "Wen di wirst mich fraign noch a mul weign deim einhorn, wer ich riefn die polizei. Sei werdn dich abhoiln."
Aber Trzebiner ist auch eine wütende Autorin, wenn sie sich über ihre nichtjüdische Freundin ärgert, die ihr erzählt, manche ältere Deutsche fänden die Wiedergutmachungsrenten für Juden problematisch. Grimmig stellt die Juristin eine "Schadensersatzliste" auf. Was vergolten werden müsste: Beschlagnahmung der Häuser von Oma und Opa. Mord an Omas Baby. Mord an Opas schwangerer Ehefrau. Experimente mit giftigen Essenzen an Oma. Leider kanzelt Trzebiner mit fast gleichem Furor Frauen ab, durch die sie ihre Beziehung bedroht sieht. Einerseits liegt die Stärke des Buches darin, dass die Autorin Banales, Alltägliches, Komisches neben Grauenhaftes stellt. Aber zu oft bleibt es ungebrochen und unironisch. Der Anspruch eines Alles-sagen-Wollens, einer sprachlichen Wahrhaftigkeit, führt dann ins Triviale und erzeugt ein Ungleichgewicht zur Wucht der Erzählung vom Alltag mit der Familie.
HANNAH LÜHMANN
Channah Trzebiner: "Die Enkelin oder Wie ich zu Pessach die vier Fragen nicht wusste".
Verlag Weissbooks, Frankfurt am Main 2013. 242 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
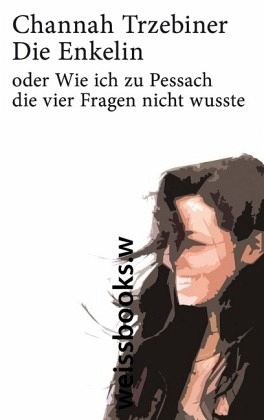





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.05.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.05.2013