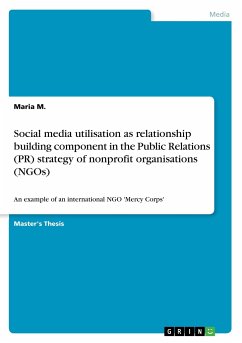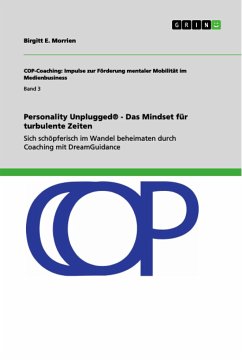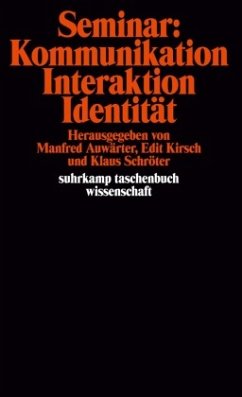Die Entdeckung der kommunikativen Welt
Studien zur kulturvergleichenden Mediengeschichte
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
25,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Eine transkulturell und epochenübergreifend arbeitende Medienwissenschaft kann weder das neuzeitliche europäische Kultur- und Geschichtskonzept noch dessen Kommunikationsmodell übernehmen. Die hier übliche radikale Orientierung an technischen Medien, an Menschen als ausschließlichen Kommunikatoren, an Standardschriftsprachen als Leitcode, am Buch als Spiegel der Kultur, am Entweder- Oder-Denken, an Homogenität und Standardisierung als Unterpfand erfolgreicher Kommunikation, Politik und Wissenschaft erweist sich als eine kulturspezifische Voraussetzung, nicht aber als allgemeingültiger T...
Eine transkulturell und epochenübergreifend arbeitende Medienwissenschaft kann weder das neuzeitliche europäische Kultur- und Geschichtskonzept noch dessen Kommunikationsmodell übernehmen. Die hier übliche radikale Orientierung an technischen Medien, an Menschen als ausschließlichen Kommunikatoren, an Standardschriftsprachen als Leitcode, am Buch als Spiegel der Kultur, am Entweder- Oder-Denken, an Homogenität und Standardisierung als Unterpfand erfolgreicher Kommunikation, Politik und Wissenschaft erweist sich als eine kulturspezifische Voraussetzung, nicht aber als allgemeingültiger Theorierahmen.
Demgegenüber versuchen die Arbeiten, die in diesem Band versammelt sind, eine alternative triadische Epistemologie und Kommunikationstheorie zu entwerfen. Dabei werden ausgewählte Kapitel der Mediengeschichte Europas, Japans, Indiens und weiterer Kulturen verglichen und der Wandel neu beschrieben.
Demgegenüber versuchen die Arbeiten, die in diesem Band versammelt sind, eine alternative triadische Epistemologie und Kommunikationstheorie zu entwerfen. Dabei werden ausgewählte Kapitel der Mediengeschichte Europas, Japans, Indiens und weiterer Kulturen verglichen und der Wandel neu beschrieben.