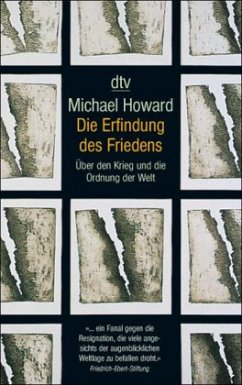Aus dem Inhalt:
1. Einleitung
2. Priester und Prinzen: 800 - 1789
3. Völker und Nationen: 1789 - 1918
4. Idealisten und Ideologen: 1918 - 1989
5. Tomahawks und Kalaschnikows
Seit Krieg für Deutschland wieder führbar geworden ist, haben sich Buchmarkt und Feuilletons seiner als Thema bemächtigt und berichten mit wohligem Schaudern über den möglichen Ernstfall. Um das Thema Frieden hingegen ist es erstaunlich ruhig geworden, seit die Bundesrepublik wieder zu einem souveränen Staat geworden und die Friedenspflicht der "Nation von Kriegsverbrechern" vergessen ist.
Michael Howard, der bedeutendste lebende Kriegshistoriker aus England, wirft in seinem Essay einen nüchternen Blick auf die Geschichte des Krieges - gerade um die große aufklärerische Idee eines "ewigen Friedens" nicht preiszugeben.
"Krieg", so lautet Howards Grundthese, "scheint so alt zu sein wie die Menschheit, Frieden aber ist eine moderne Erfindung". In der ganzen menschlichen Geschichte war Krieg für die überwältigende Mehrzahl der Gesellschaften eine selbstverständliche Angelegenheit, durch die Rechts- und Sozialstruktur entscheidend geprägt wurden. Erst seit der Aufklärung gilt Krieg als das Übel schlechthin, das durch eine rationale soziale Organisationsform abgeschafft werden soll, eine Vorstellung, die nach den Weltkriegen zum Daseinsgrund von Völkerbund und Vereinten Nationen geworden ist.
Dennoch scheinen seit einigen Jahren Anzahl und Intensität kriegerischer Konflikte wieder zuzunehmen. Ist Krieg also nach wie vor ein unvermeidlicher Bestandteil der internationalen Ordnung? Sind Krieg und Frieden immer noch zwei Seiten einer Medaille? Verändert die aktuelle Schwächung der Nationalstaaten nur die Art der Kriegsführung oder läutet sie ein Ende des Krieges ein?
Im Anschluss an die Betrachtung der großen historischen Veränderungen im Verhältnis von Gesellschaft und Krieg kommt Howard in seinem brillanten Essay, der als eine Bilanz seiner lebenslangen Studien gelten kann, auf die Bedingungen zu sprechen, unter denen die Idee eines ewigen Friedens nach den Veränderungen von 1989 realisiert werden könnte.
1. Einleitung
2. Priester und Prinzen: 800 - 1789
3. Völker und Nationen: 1789 - 1918
4. Idealisten und Ideologen: 1918 - 1989
5. Tomahawks und Kalaschnikows
Seit Krieg für Deutschland wieder führbar geworden ist, haben sich Buchmarkt und Feuilletons seiner als Thema bemächtigt und berichten mit wohligem Schaudern über den möglichen Ernstfall. Um das Thema Frieden hingegen ist es erstaunlich ruhig geworden, seit die Bundesrepublik wieder zu einem souveränen Staat geworden und die Friedenspflicht der "Nation von Kriegsverbrechern" vergessen ist.
Michael Howard, der bedeutendste lebende Kriegshistoriker aus England, wirft in seinem Essay einen nüchternen Blick auf die Geschichte des Krieges - gerade um die große aufklärerische Idee eines "ewigen Friedens" nicht preiszugeben.
"Krieg", so lautet Howards Grundthese, "scheint so alt zu sein wie die Menschheit, Frieden aber ist eine moderne Erfindung". In der ganzen menschlichen Geschichte war Krieg für die überwältigende Mehrzahl der Gesellschaften eine selbstverständliche Angelegenheit, durch die Rechts- und Sozialstruktur entscheidend geprägt wurden. Erst seit der Aufklärung gilt Krieg als das Übel schlechthin, das durch eine rationale soziale Organisationsform abgeschafft werden soll, eine Vorstellung, die nach den Weltkriegen zum Daseinsgrund von Völkerbund und Vereinten Nationen geworden ist.
Dennoch scheinen seit einigen Jahren Anzahl und Intensität kriegerischer Konflikte wieder zuzunehmen. Ist Krieg also nach wie vor ein unvermeidlicher Bestandteil der internationalen Ordnung? Sind Krieg und Frieden immer noch zwei Seiten einer Medaille? Verändert die aktuelle Schwächung der Nationalstaaten nur die Art der Kriegsführung oder läutet sie ein Ende des Krieges ein?
Im Anschluss an die Betrachtung der großen historischen Veränderungen im Verhältnis von Gesellschaft und Krieg kommt Howard in seinem brillanten Essay, der als eine Bilanz seiner lebenslangen Studien gelten kann, auf die Bedingungen zu sprechen, unter denen die Idee eines ewigen Friedens nach den Veränderungen von 1989 realisiert werden könnte.

Wenn du den Frieden erklären willst, bereite den Krieg nach. So könnte man Michael Howards Strategie beschreiben, der er beim Abfassen seines schmalen Buches gefolgt ist: 111 Seiten über den Frieden und alles voller Krieg. Das Bändchen ist dennoch von einigem Gewicht - inhaltlich betrachtet. Es ist entstanden aus den Vorbereitungen einer Vorlesung, mit der der britische Autor im vergangenen Jahr die Anglo-amerikanische Konferenz über Krieg und Frieden an der Universität London eröffnet hat. Erfreulicherweise wurde das Original rasch übersetzt, so daß auch wir nun lesen können, was kaum anders zu beschreiben ist als die Summa eines fast achtzigjährigen Lebens (Michael Howard: "Die Erfindung des Friedens". Über den Krieg und die Ordnung in der Welt. Aus dem Englischen von Michael Haupt. Verlag zu Klampen, Lüneburg 2001. 111 S., geb., 29,80 DM).
Howard ist einer der bedeutendsten Militärhistoriker und Mitbegründer des Institute for Strategic Studies. Dementsprechend ist die Kriegslastigkeit seines Essays biographisch nur konsequent. Sie ist es jedoch auch argumentativ. "Frieden", so hebt das Buch an, " ist eine sehr viel komplexere Angelegenheit als Krieg", und deshalb ist er für Howard das jüngere Phänomen. Das heißt nicht, daß er sich auf die Seite von Hobbes stellt, der den Frieden als bloßes Akzidenz des Kriegs beschrieben hat, denn zum Krieg gehört für Howard seit der Heraufkunft des christlichen Glaubens immer die Hoffnung auf Frieden. Sie liefert die Rechtfertigung für Kriegführung, seit die gesellschaftliche Vorreiterrolle des Adels als eine Kriegerkaste beseitigt wurde - erst intellektuell durch die Aufklärung, dann politisch durch das Zeitalter der Revolutionen.
Auf engstem Raum wird indes ein Zeitraum abgehandelt, der noch viel weiter gespannt ist: von der Kaiserkrönung Karls des Großen bis in die unmittelbare Gegenwart. Dabei leistet Howard für jede Epoche die Verbindung zwischen sozialen und militärischen Entwicklungen; großartig sind etwa seine schlaglichtartigen Betrachtungen zu Napoleons Ära, zu Hitlers Rolle, aber auch zu Kant, den Howard als den einzigen hellsichtigen Theoretiker des Friedens anerkennt, weil der Philosoph nicht den utopischen, sondern einen evolutionären Pfad zum Weltfrieden beschrieben habe.
Die zentrale Frage, die Howard für die Vergangenheit erhebt, lautet: Was tut der Soldat, wenn der Frieden ausbricht? Die Wortwahl allein zeigt, daß der englische Historiker Frieden sowenig als Normalfall betrachtet wie Krieg. Von Urzustand - ob idyllisch à la Rousseau oder chaotisch im Hobbesschen Sinne - ist gar keine Rede. Bei Howard gehen beide ein dialektisches Spiel ein, und der Widerstreit der vom jeweiligen Zustand profitierenden Klassen läßt das entstehen, was wir Geschichte nennen. Somit haben die Dinge neben ihrem Vater, wie Herodot den Krieg genannt hat, im Frieden nunmehr auch ihre Mutter gefunden. Ein Elternteil allein genügt nicht.
Das wird auf Beifall in der öffentlichen Meinung stoßen, weniger jedoch Howards schlüssige Folgerung, daß die Sehnsucht nach Frieden eher aus Neid denn aus Widerstand gegen das Schlachten entstanden ist: "Gerade weil das Bürgertum", so hält der Autor für das Zeitalter der Aufklärung fest, "so wenig involviert war, konnte es Krieg als eine Aktivität ansehen, der Monarchen, Aristokraten und der Abschaum der Gesellschaft zu ihrem eigenen Vergnügen nachgingen. Zivilisierten Menschen hingegen war er fremd und zudem gänzlich überflüssig." Denn die Geschäfte laufen besser ohne ihn, kriegerische Verwicklungen gefährden die Wirtschaft. Deshalb ist die Zivilisierung in diesem Kontext ganz unpathetisch und streng etymologisch zu verstehen: als Verbürgerlichung, die alle moralischen Argumente nur zur Beförderung ihrer materiellen Interessen anführte.
Nun ist Howard alles andere als ein materialistischer Historiograph, was schon sein Faible für Kant beweist. Sein Essay läuft auf eine Definition von Frieden zu, die mit Kant gegen jedes Globalisierungsmodell formuliert wird: "Frieden ist die Ordnung, wie unvollkommen auch immer sie sein mag, die aus Vereinbarungen zwischen Staaten hervorgeht und nur durch diese Vereinbarungen aufrechterhalten werden kann." Die Betonung liegt auf "nur", und die Bestimmung ist insofern hochbrisant, als sie in sämtlichen Auseinandersetzungen lediglich dem Staat die Fähigkeit zuschreibt, die Angelegenheiten friedlich zu regeln. Denn "friedlich" heißt bei Howard soviel wie "staatlich". Wenn er als den großen Dissens der Menschheitsgeschichte den Streit darum bezeichnet, ob Frieden bewahrt oder bewirkt werden muß, so zeigt sich jedoch das Dilemma seiner Definition, denn bereits existierende Staaten dürften immer jener Gruppe zuzurechnen sein, die Frieden bewahren will, während noch nicht staatlich etablierte Gesellschaften ihn erst bewirken wollen, indem sie Staaten werden. Wenn nur Staaten Frieden machen können, ist der Krieg garantiert.
Vom Historiker aber darf man nicht erwarten, daß er ein Friedensmodell erstellt. Howard beschreibt brillant, was bislang gewesen ist. Seine Sympathien gehören nicht den Nationalbewegungen, können es auch gar nicht, denn je komplexer die Staatengemeinschaft, desto schwieriger muß es nach seiner Vorstellung werden, Frieden zu schließen. Sein Ideal ist, wieder mit Kant, der souveräne Staat, der nur bestehen kann, wenn dessen Bevölkerung treu zu ihm steht - aus welchen Gründen auch immer. Dazu aber fehlt vor allem den jungen postkolonialen Staaten die Kriegserfahrung, der "Initiationsritus", wie Howard den Kampf um staatliche Selbständigkeit nennt. Die moderne Geschichtsschreibung sollte prüfen, ob sie nicht auch das noch den Europäern vorwerfen kann: daß sie die von ihnen unterjochten Völker ohne Krieg freigegeben und ihnen damit den Frieden geraubt haben.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"In seinem brillanten Buch entfaltet der Militärhistoriker Michael Howard die seltsame und prekäre Natur des Friedens sowie die drängenden Fragen, die sich daraus für unsere Zeit ergeben. Zwar konzentriert er sich auf einen besonders blutigen Kontinent: das Europa der letzten 1.200 Jahre. Doch seine Schlussfolgerungen sind von globaler Bedeutung." (Financial Times)
"Howards knappes Werk erzählt eindringlich sowohl vom Grauen als auch von der fatalen Anziehungskraft des Krieges. Sollten, so fragt er, wohlmeinende Kantianer froh über die Erosion der Staatsgewalt sein? Vielleicht, "aber der Staat macht nicht nur Krieg: er macht auch Frieden möglich." Kriege sind den Menschen meist irrational erschienen. Und trotzdem wurden sie geführt. Howard zufolge ist Frieden als eine stabile Ordnung noch nicht erfunden worden. So hofft er, dass wenigstens Kants "Keim der Aufklärung" überlebt. In diesem Werk jedenfalls gedeiht er." (The Sunday Times)
"Die durchgängig geglückte Darstellungswe ise besticht. Und es ist eine Wohltat, von einem so gebildeten Menschen zu hören, dass der ewige Friede letztlich doch nicht durch die weltweite Ausbreitung von Hamburgerbuden befördert wird." (Evening Standard)
"Michael Howard ist, so kann man wohl behaupten, Großbritanniens größter lebender Historiker. In seinem gesamten Arbeitsleben hat er sich hauptsächlich mit dem Thema Krieg auseinandergesetzt (...). Dieses knappe Buch ist daher Destillat aus lebenslangen Forschungen und Reflexionen. Luzide, zwingend und scheinbar leichthändig geschrieben, ist es das Werk eines Mannes, der ebenso weise wie gelehrt ist und dessen literarische Fähigkeiten sich auf einem ähnlich hohen Niveau bewegen wie seine anderen Begabungen." (The Spectator)
"Das Buch von Michael Howard ist so voller Ideen, dass es jeden begeistern wird, der sich auch nur im geringsten für die Frage interessiert, wie die Welt an ihren derzeitigen Entwicklungspunkt gelangt ist." (The Irish Times)
"Howards knappes Werk erzählt eindringlich sowohl vom Grauen als auch von der fatalen Anziehungskraft des Krieges. Sollten, so fragt er, wohlmeinende Kantianer froh über die Erosion der Staatsgewalt sein? Vielleicht, "aber der Staat macht nicht nur Krieg: er macht auch Frieden möglich." Kriege sind den Menschen meist irrational erschienen. Und trotzdem wurden sie geführt. Howard zufolge ist Frieden als eine stabile Ordnung noch nicht erfunden worden. So hofft er, dass wenigstens Kants "Keim der Aufklärung" überlebt. In diesem Werk jedenfalls gedeiht er." (The Sunday Times)
"Die durchgängig geglückte Darstellungswe ise besticht. Und es ist eine Wohltat, von einem so gebildeten Menschen zu hören, dass der ewige Friede letztlich doch nicht durch die weltweite Ausbreitung von Hamburgerbuden befördert wird." (Evening Standard)
"Michael Howard ist, so kann man wohl behaupten, Großbritanniens größter lebender Historiker. In seinem gesamten Arbeitsleben hat er sich hauptsächlich mit dem Thema Krieg auseinandergesetzt (...). Dieses knappe Buch ist daher Destillat aus lebenslangen Forschungen und Reflexionen. Luzide, zwingend und scheinbar leichthändig geschrieben, ist es das Werk eines Mannes, der ebenso weise wie gelehrt ist und dessen literarische Fähigkeiten sich auf einem ähnlich hohen Niveau bewegen wie seine anderen Begabungen." (The Spectator)
"Das Buch von Michael Howard ist so voller Ideen, dass es jeden begeistern wird, der sich auch nur im geringsten für die Frage interessiert, wie die Welt an ihren derzeitigen Entwicklungspunkt gelangt ist." (The Irish Times)