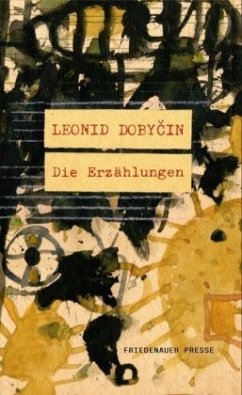1987 wurde Joseph Brodsky, frisch gekürter Nobelpreisträger für Literatur, von Studenten gefragt, welchen russischen Prosaschriftsteller er im XX. Jahrhundert für den bedeutendsten halte. Brodsky zögerte mit einer Antwort, und als ihm Namen wie Babel, Bulgakov und Platonov zugeraunt wurden, sagte er schnell und bestimmt: »Dobycin. Leonid Dobycin«, einen Autor, der selbst in Rußland den wenigsten bekannt war. An ihm - er lebte 1894 bis 1936 - bestachen Brodsky die »Gogolsche Kraft«, »das geschärfte Gefühl für die Semantik«, die »Proustsche Aufmerksamkeit für das Detail (das in seiner Bedeutung die Hauptsache überwuchere)« und eine »starke Joycesche Note«, bezogen wohl vor allem auf The Dubliners.Alle diese Eigenheiten erkannte Brodsky an Dobycins Roman Die Stadt N. (1935): »Leben in der Provinz. Alles geschieht wie immer in der russischen Provinz, genauer: nichts geschieht. Geschehen war, übrigens, die Revolution.«Die hier vorgelegten kurzen Erzählungen Dobycin - sie erschienen zwischen 1924 und 1930 verstreut in literarischen Zeitschriften und Almanachen Leningrads - bilden so etwas wie das Manifest des erzählerischen Stils dieses Autors, der sich im übrigen theoretisch nie geäußert hat, es sei denn in aphoristischen Bemerkungen in Briefen. Dobycins Erzählstil ist geprägt von Puskins Diktum über die künstlerische Prosa »Genauigkeit und Kürze« wie von Anton Cechovs Forderung nach »äußerster Kürze«. Diese Forderung wird von Dobycins Erzählungen nochmals radikal reduziert auf ein Minimum des Möglichen und Allernötigsten. Die Rolle des Erzählers entfällt bzw. wird übernommen von einer imaginären, absolut objektiven Filmkamera, deren Aufnahmen eben jener »treffenden Details« mit der modernen Schnittechnik der Montage neu zusammenfügt: russische Provinz, hier die westrussische Kleinstadt Brjansk in den Jahren nach der Revolution: »Alles geschieht wie immer in der russischen Provinz, genauer: nichts geschieht.« Nur daß dieses »Nichts« in Wirklichkeit ungeheuer viel - bei Dobycin Konzentration und Dichte erlangt, wie sie erzählerische Prosa im Russischen nie wieder erreicht hat: Dobycin rückt die Gattung der Prosaminiatur an die Grenze zum epischen, bisweilen sogar lyrischen Gedicht.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Endlich gibt es eine deutsche Edition des Gesamtwerks des Leningrader Avantgardisten Leonid Dobycin, freut sich Rezensentin Judith Leiser, die den Vergleich Dobycins mit Puschkin, Tschechow und Babel nicht scheut. Auch wenn in Dobycins Prosa laut Leiser nicht allzu viel passiert, ist sie ganz angetan von dem energisch "vibrierenden Stillstand", der die nahezu expressionistischen Sätze durchweht. Sie folgt der Kritik des Autors am Sozialismus, erhält tiefgreifende Einblicke in die Gesellschaft und Provinzen der Sowjetunion und bewundert insbesondere den kunstvollen Umgang mit der Sprache, die sinnlich, "anmutig" und zugleich klar erscheint.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Niemand hat es vor ihm gewagt, die junge, angeblich hoffnungsvolle sowjetische Gesellschaft derart schonungslos zu betrachten. Jetzt liegen die Erzählungen von Leonid Dobycin in der deutschen Übersetzung von Peter Urban vor.
Als der Nobelpreisträger Joseph Brodsky 1987 von Studenten in Harvard gefragt wurde, wen er für den größten russischen Prosaautor nach 1917 halte, antwortete er, ohne zu zögern: Leonid Dobycin. Diesen Namen hatte im Auditorium noch niemand gehört, und das verwundert nicht, denn auch in Russland wurde Dobycin erst nach der Wende entdeckt. Seine politisch harschen, sarkastischen und genau beobachtenden Texte verstand die Sowjetmacht damals - völlig zu Recht - als Provokation.
Die zwischen 1924 und 1930 entstandenen Erzählungen zeigen ein verstörtes Land, das überrollt und überfordert ist von den politischen Ereignissen. Die Menschen versuchen weiterzuleben wie bisher, aber der Umerziehungsdruck, unter dem sie stehen, macht das unmöglich. Manch einer schwimmt daraufhin "über die Biegung hinaus", wie es lapidar in der programmatischen Geschichte "Begegnungen mit Liz" heißt. Auch der Autor selbst hielt den politischen Angriffen nicht stand und nahm sich, nachdem man ihn wegen seines ersten Romans "Die Stadt N" zum Volksfeind erklärt hatte, 1936 das Leben.
Niemand hatte es vor ihm gewagt, die junge, angeblich so hoffnungsvolle sowjetische Gesellschaft derart schonungslos zu betrachten. Und erst die genaue und sprachmächtige Übersetzung des soeben verstorbenen Übersetzers Peter Urban offenbart die ganze Schärfe und Lakonik dieser Geschichten (die Alfred Frank in der Leipziger Ausgabe 1992 noch geglättet und besänftigt hatte). Scheinbar erzählen sie von nichts: ohne Handlung, "ohne Helden, Farben und Fanfaren", wie Urban schrieb, stellen sie fotografisch genaue Momentaufnahmen und beiläufige Szenen in knappen, strengen Hauptsätzen nebeneinander. Aber sie sind so angeordnet und akzentuiert, dass ein überwältigend sinnlicher und genauer Eindruck vom Leben in den beiden Kleinstädten entsteht, in denen die Geschichten spielen (und in denen der Autor fast sein ganzes Leben verbrachte). Nur eine Erzählung, "Die Tante", spielt in Leningrad, wo Dobycin seine glücklichsten Jahre verbrachte und, wie sein Alter Ego, der Buchhalter Kunst, zum ersten Mal ein eigenes Zimmer besaß.
Ein Seelenverwandter von Tschechow schreibt hier, der ohne psychologische Erklärungen auskommt, nie von Seelenzuständen erzählt und kaum Landschaftsbeschreibungen liefert - sondern nur mit dem absolut treffenden Detail arbeitet, mit scheinbar unmotivierten Handlungen, verräterischen Gesten und Dialogen, die aus fünfzehn Worten bestehen. Dobycin schafft es durch seine präzisen Sätze, in denen fast jedes neue Bild auch einen neuen Gedanken einführt, die Tiefenschichten einer zwangspolitisierten Gesellschaft offenzulegen, die ihre Unsicherheit hinter absurden Propagandafloskeln versteckt und dem kleinbürgerlichen Geist in all seinen Facetten huldigt. Gleichzeitig hat er tiefes Mitgefühl mit den Ratlosen und Einsamen, die zwischen "Physkultura" und beginnenden Säuberungen ("Material"), seelischen Folterszenarien ("Der Garten") und absurden Kulturveranstaltungen ("Das Porträt") umherirren.
Die schönste Geschichte, "Evdokija", spielt in einem (heute) lettischen Provinzstädtchen zu Beginn des Ersten Weltkrieges und erzählt mit groteskem Witz von den tödlichen Spannungen unter der verschlafenen Oberfläche. Die mal träumerische, mal resolute und gern Verwirrung stiftende Hauptfigur war Dobycins erklärte Lieblingsfigur, und es ist den sorgsamen Anmerkungen des jüngst verstorbenen Übersetzers Peter Urban zu danken, dass wir ihre spöttischen Sprachspiele und politischen Kurzschlüsse so genau verstehen - sein ganzes Können steckt in dieser Arbeit, seiner letzten.
NICOLE HENNEBERG
Leonid Dobycin: "Die
Erzählungen".
Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von Peter Urban. Friedenauer Presse, Berlin 2013. 216 S., geb., 22,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main