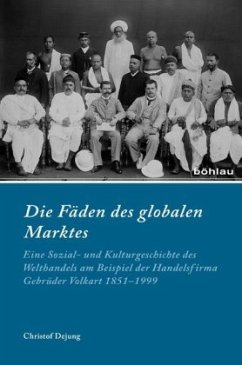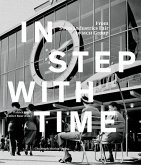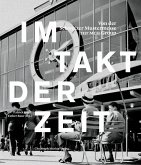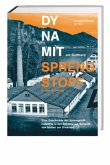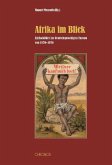Das Handelshaus Gebrüder Volkart exportierte ab 1851 Baumwolle und andere Kolonialwaren aus Indien und wurde bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer der größten Kaffee- und Baumwollhandelsfirmen der Welt. Inwiefern profitierte Volkart als Schweizer Firma vom Ausbau der britischen Kolonialherrschaft in Südasien? Weshalb kam es zu Spannungen zwischen multinational operierenden Handelshäusern und kolonialen Bürokratien? Wie gelang es europäischen Firmen, Netzwerke mit einheimischen Kaufleuten in verschiedenen Teilen der Welt zu knüpfen? Inwiefern wurden globale Märkte durch die Handlungsmacht indigener Bauern und Zwischenhändler mitgeprägt? Diese Studie greift auf einen umfangreichen, bisher weitgehend unerschlossenen Quellenbestand zurück. Sie verortet sich an der Schnittstelle von Wirtschafts-, Global- und Kulturgeschichte und legt dar, dass Märkte nicht bloß Orte von materiellem Austausch waren, sondern auch soziale Strukturen darstellten, die sich durch die Handlungen einzelner Akteure herausbildeten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Volkart war der größte Exporteur von Kaffee in der Welt
Was haben kleine Handelsfirmen wie die Schweizer Gebrüder Volkart in der Welt großer multinationaler Unternehmen verloren? Das Buch des Konstanzer Historikers Christof Dejung beantwortet diese Frage für den Zeitraum vom Höhepunkt des Kolonialismus bis zur Globalisierung des späten 20. Jahrhunderts. Er konnte sich dabei auf eine überraschend dichte Überlieferung im Firmenarchiv des Schweizer Hauses stützen. Zudem hat er 23 weitere Archive in sieben Ländern aufgesucht. Es gelingt ihm, einen lange und zu Unrecht vernachlässigten Unternehmenstypus zu untersuchen sowie die Geschichte des Handels mit den Rohstoffen Baumwolle und Kaffee detailliert darzustellen.
Diese Doppelperspektive stellt das Grundprinzip der Arbeit und ihre größte Stärke dar. Durch den mikrohistorischen Zugriff gewinnt sie Tiefenschärfe und erfasst Details, die allgemeinen Globalisierungsstudien verschlossen bleiben. Die Arbeit belegt, dass kleine Handelsfirmen eine zentrale Funktion im Globalisierungsprozess besaßen, da sie spezifische Vertrauensund Informationslücken schlossen und lokale Netzwerke mit globalen verknüpften.
So wurde Volkart zeitweilig größter Exporteur von Baumwolle des indischen Subkontinents und größter Kaffeeexporteur der Welt. Zudem wird deutlich, dass gängige Globalisierungsmodelle wie dasjenige des amerikanischen Wissenschaftlers Immanuel Wallerstein mit einer simplen Gegenüberstellung von Zentrum und Peripherie unzutreffend sind. Die Grenzen waren fließend, und der Welthandel mit Baumwolle blieb im 19. Jahrhundert keineswegs einseitig auf Großbritannien ausgerichtet. Gerade der Fall der Kronkolonie Indien belegt eine enge Verknüpfung verschiedener Peripherien sowie komplexe multidirektionale Beziehungen.
Ferner relativiert die Arbeit Dejungs die Bedeutung des Kolonialismus für die Globalisierung im Zeitalter des Imperialismus. Als Schweizer Unternehmen profitierte Volkart nur indirekt von der kolonialen Herrschaft. Die dominanten Produktions- und Handelsstrukturen waren keinesfalls deckungsgleich mit den kolonialen Interessenlagen. Zwar besaßen Infrastrukturinvestitionen wie der Bau der indischen Eisenbahn oder des Suezkanals eine herausragende Bedeutung. Eingriffe der Kolonialbehörden in den Markt waren jedoch weitgehend wirkungslos.
Schließlich weist Dejung nach, dass es keine rigorose Trennung - weder kulturell noch kommerziell - zwischen europäischen und asiatischen Kaufleuten gab. Vielmehr handelte es sich um ein hochgradig integriertes Feld. Man könnte fast von einem europäisch-asiatischen Gemeinschaftsprojekt sprechen. Das gilt cum grano salis auch für die in vielem anders gelagerten Verhältnisse in Lateinamerika, wo Volkart nach 1945 groß in den Kaffeehandel einstieg. Minutiös weist Dejung auf allen Ebenen Verschränkungen nach, die von Kredit- bis zu Arbeitsbeziehungen reichten. Eine Verbindung besonderer Art stellte die Korruption dar, eine gängige Geschäftspraxis, deren Problematik in der Schweizer Zentrale durchaus gesehen wurde. Das Unternehmen machte sich angreifbar, die Bücher stimmten nicht, und die Loyalität der entsandten Mitarbeiter wurde fraglich. Abstellen ließ sich die Bestechung trotz aller Bedenken nicht.
Das Buch räumt auf mit der einseitig eurozentrischen Sichtweise des Rohstoffhandels des 19. und 20. Jahrhunderts. Es zeigt aber auch, dass die anfangs sehr große Bedeutung indischer Kaufleute im Laufe des 19. Jahrhunderts erheblich abnahm. Die Studie hat trotz ihrer enormen Verdienste einige Lücken. So erfährt man wenig über den betriebswirtschaftlichen Kern des Geschehens. Die Arbeit ist arm an quantitativen Informationen.
Daneben fällt auf, dass die soziokulturelle Keimzelle des Unternehmens, nämlich die Familie Volkart, unterbelichtet bleibt. Die Studie nutzt weder die breite Debatte über Familienunternehmen noch die Ergebnisse der historischen Biographik und der Bürgertumsforschung. Schließlich wird Volkarts Abschied vom Handelsgeschäft in den achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts mehr konstatiert als analysiert. Es bleibt offen, warum die von Volkart geschaffenen Teilfirmen mit anderen Eigentümern bis in das 21. Jahrhundert hinein florieren.
Gegenüber den vielen Verdiensten der Arbeit verblassen diese Einwände. Diese in allgemeiner Absicht verfasste Mikrostudie schreibt Globalisierungsgeschichte aus der Perspektive der Akteure. Stets gelingt es, die Balance zwischen Mikro- und Makroebene zu wahren. Die theoretisch anspruchsvolle Arbeit gleitet nie in den menschenfeindlichen Jargon mancher Theoriedebatten ab. Der Autor hat die Ergebnisse einer langjährigen Fleißarbeit und klugen Interpretation vorgelegt, deren Lektüre zudem auch ein ausgesprochenes Vergnügen ist.
HARTMUT BERGHOFF.
Der Rezensent leitet das Deutsche Historische Institut in Washington D. C. und lehrt Wirtschaftsgeschichte an der Universität Göttingen.
Christof Dejung: Die Fäden des globalen Marktes.
Böhlau, Köln/Weimar/Berlin 2013, 516 Seiten, 59,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main