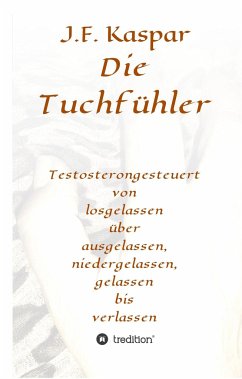"Juwelier Friedrich" - ein Markenname, eine Legende, ein Synonym für Glanz und Schönheit - und ein Ort, an dem Geschichten blühen. Stephan Friedrich, der gemeinsam mit seinem Bruder das Geschäft des Vaters und Firmengründers Karl Friedrich übernommen hatte, machte aus dem Stammhaus in der Frankfurter Goethestraße eine weltweit bekannte, für ihre Kreativität und Seriosität berühmte Adresse, ein Haus, das Schmuckgeschichte geschrieben hat.
Heute hat sich Stephan Friedrich zurückgezogen und erinnert sich: an Begegnungen mit Barbara Streisand und Kaiser Haile Selassie, an den betrügerischen Baron von Jessingen und an die Entführung seines Bruders, an eine ganz besondere Taucheruhr und einen liebestollen Galan mit aufregender Begleitung. Friedrichs außergewöhnlich gut gelaunte, witzige und prickelnde Geschichten könnten in seinem Atelier entstanden sein: Sie selbst sind Brillanten von erheblichem Wert.
Heute hat sich Stephan Friedrich zurückgezogen und erinnert sich: an Begegnungen mit Barbara Streisand und Kaiser Haile Selassie, an den betrügerischen Baron von Jessingen und an die Entführung seines Bruders, an eine ganz besondere Taucheruhr und einen liebestollen Galan mit aufregender Begleitung. Friedrichs außergewöhnlich gut gelaunte, witzige und prickelnde Geschichten könnten in seinem Atelier entstanden sein: Sie selbst sind Brillanten von erheblichem Wert.

In seinen Jahrzehnten als Juwelier an der Frankfurter Goethestraße hat Stephan Friedrich Kurioses erlebt und Abenteuer überstanden. Ein Buch gewährt nun Einblicke.
Von Sabine Börchers
FRANKFURT. Große Juweliere müssen ähnlich verschwiegen sein wie Anwälte oder Ärzte. Gilt bei ihnen auch keine gesetzliche Schweigepflicht, so doch offenbar ein Berufsethos, welches ihnen nahelegt, über das mit den meist exklusiven Kunden Erlebte nicht zu sprechen, schon allein aus Sicherheitsgründen. Zumindest wird selten öffentlich, was sich hinter den ohnehin blickdichten Fassaden der Preziosenverkäufer abspielt. Stephan Friedrich macht jetzt eine Ausnahme. Der Juwelier, der 33 Jahre lang gemeinsam mit seinem Bruder Christoph das gleichnamige Geschäft führte, plaudert in einem im Verlag Weissbooks erschienenen Buch mit dem Titel "Die falsche Liz Taylor" über seine Erlebnisse.
Die beiden Brüder sind bekannte Persönlichkeiten in Frankfurt. So bekannt, dass sie für das Geschäft an der Goethestraße jahrelang in dieser Zeitung ohne Namensnennung, nur mit einem Foto von sich und dem Satz "Wenn Sie uns kennen, müssen Sie edlen Schmuck haben" warben. Viele solcher Juwelen-Liebhaber hat Friedrich erlebt. Jene, die sie sich leisten konnten, aber auch andere, die sie trotzdem begehrten. So wie ein Trickdieb, der versuchte, einen 1,5 Karäter gegen einen unechten Stein auszutauschen, oder ein Mann mit markanter Batschkapp auf dem Kopf, der sich mit falscher Identität Schmuck ergaunerte. Unglücklicherweise wurde er für einen langjährigen Kunden aus Hamburg gehalten, so dass man ihm Schmuck für eine knappe halbe Million Mark (etwa 240 000 Euro) anvertraute, den er seiner Frau zeigen wollte.
"In einem inhabergeführten Geschäft kann man so etwas schon mal machen", sagt Friedrich, musste aber in diesem Fall feststellen, dass ein solcher Vertrauensvorschuss, der bei den meisten Kunden gerechtfertigt ist, schmerzhaftes Lehrgeld kosten kann: Der Mann und der Schmuck tauchten nie wieder auf. Unzählige schlaflose Nächte habe er in seinem Berufsleben verbracht, gibt Friedrich zu. Denn selbst Prinz Faisal, einer der Söhne des saudischen Königs, bezahlte den in Empfang genommenen Schmuck von ähnlichem Wert erst nach etwa drei Monaten.
Solche Begebenheiten könne man als Außenstehender nur verstehen, wenn man sich vor Augen führe, dass ein Juwelier den Wert der Ware, mit der er handelt, vergessen müsse, hebt der Juwelier hervor - und verrät, dass er früher Schmuckkoffer zu Hause meist im Auto aufbewahrt habe, "weil das niemand erwartet hat". Ein weiteres Beispiel aus den achtziger Jahren führt er im Buch aus: Weil Friedrich zu einem Essen bei einem Sternekoch im Elsass eingeladen war, von einem anderen Kunden, den er in der Nähe besucht hatte, aber einen Koffer voller Juwelen im Wert von rund einer Million Mark dabei hatte, stand er vor einem Problem. Den Schmuck durfte er damals nicht mit über die französische Grenze nehmen. Also suchte er sich kurzerhand in der Nähe ein abgelegenes Waldstück und versteckte den Koffer in einem Gebüsch. Auf dem Heimweg holte er ihn wieder ab. Dass seiner Frau im Restaurant aus Sorge um die Juwelen der Appetit vergangen war, lässt er allerdings nicht unerwähnt.
Solche und andere Erlebnisse, etwa, wie die amerikanische Sängerin Barbra Streisand in einer Fernsehshow für den Juwelier Werbung machte, oder wie Friedrich einer Freundin von Liz Taylor die Perücke mit Platin-Diadem rettete, finden sich im Buch. Bei allen schwingt ein wenig Nostalgie mit. Sie ereigneten sich zumeist in den achtziger Jahren, als Juweliergeschäfte noch keine Klingeln an den Türen hatten. Dennoch, das bestätigt Friedrichs Nachfolger Marc Stabernack, der das Unternehmen 2010 kaufte, sei es in einem inhabergeführten Betrieb auch heute noch möglich, Geschäfte per Handschlag abzuschließen.
Dass die meisten Vorkommnisse positiv endeten, machte es Stephan Friedrich naturgemäß leichter, darüber zu schreiben. Selbst ein sehr persönliches Erlebnis lässt er daher nicht aus, die Entführung seines Bruders im Juni 1983. Auch sie ging glimpflich aus, weil der Bruder aus dem Kofferraum des Entführerwagens den nachfolgenden Autofahrern Zeichen geben konnte.
Aufgeschrieben hat Stephan Friedrich die Episoden, nachdem er das Geschäft an Marc Stabernack verkauft hatte. Drei Jahre lang arbeitete er an den Texten, mit denen er auch an seinen Vater erinnern will, der das Geschäft 1947 gründete und zum Erfolg führte. Ihm ist die längste Geschichte gewidmet. 1970 kaufte der Vater für 365 000 Mark einen besonderen Diamanten, den nahezu lupenreinen "Deepdene" mit antikem Schliff und mehr als 100 Karat. Für den Vater wurde der Stein allerdings zum Fluch.
Ein langwieriger Expertenstreit darüber, ob der Stein künstlich gefärbt sei, hatte Friedrich zwar weltweit in die Medien gebracht, schadete aber zugleich seinem Ansehen. Erst die beiden Söhne konnten die Unsummen, die der Vater für Gutachten und Rechtsstreitigkeiten ausgegeben hatte, mit dem Verkauf ausgleichen. Drei Jahrzehnte nach dem Erwerb veräußerten sie den besonderen Stein für 1,25 Millionen Mark.
Eine exakte Kopie des Steins aus Citrin, die Friedrich einst herstellen ließ, war noch lange in Familienbesitz. Sie ist mittlerweile verschenkt. Selbst die Tatsache, dass das Geschäft in einigen Jahren die Goethestraße verlassen muss, lässt ihn nur etwas wehmütig werden. Die kostbarsten Erinnerungen an seine beruflichen Jahre, die Friedrich nach seinen Worten trotz der Sorgen als sehr bereichernd empfunden hat, bewahrt er im Kopf und jetzt voller Stolz im Leineneinband auf Papier. Die eine oder andere Begebenheit aus seiner Zeit fand allerdings noch keinen Eingang in das Buch. Das lag auch daran, dass es zumindest in einem Fall ein stadtbekannter Herr gewesen sei, der regelmäßig Schmuck bei ihm gekauft habe, allerdings mit Geld, das ihm nicht gehörte. Die Geschichte, mit verändertem Namen, schreibe er für das nächste Buch, sagt Friedrich lächelnd.
Stephan Friedrich: Die falsche Liz Taylor. Ein Juwelier erzählt. Weissbooks-Verlag, Frankfurt, 201 Seiten, mit Lesebändchen, 22 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main