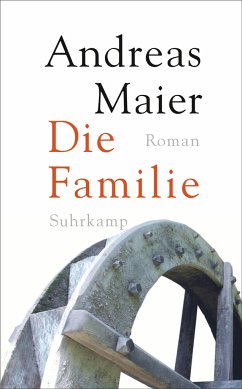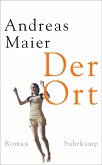Andreas Maier schildert in hochkomischer und abgründiger Weise die komplette Selbstzerstörung eines Familien-Idylls. Tranken die Vorfahren noch in scheinbar gemütlichster Weise familieneigenen Apfelwein miteinander, umgeben von Obstbäumen und Hühnern und Ziegen, geht es in den späteren Generationen - ebenso scheinbar - ständig um Erbfälle, ein riesiges Grundstück, ein böswilliges Denkmalschutzamt mitsamt Baggerführer, um schräge Kinder und chaotische Enkel. Irgendwann wird dem 1967 geborenen Erzähler stellvertretend für seine Generation klar: »Wir sind die Kinder der Schweigekinder.« Das Begreifen der eigenen Familiengeschichte setzt vor einem Grabstein ein, weit außerhalb der Stadt Friedberg in der Wetterau.
»Der Autor beginnt noch einmal; 'ganz von vorn' puzzelt er sich seine Herkunft zusammen. ... Er, das 'Kind der Schweigekinder', stellt fest: 'Ich schreibe die ganze Zeit Nachkriegsliteratur, ohne es zu merken.' Spätestens im Epilog wird deutlich, wie klug er dabei vorgegangen ist.« Marlene Grunert Frankfurter Allgemeine Zeitung 20190808

Andreas Maier puzzelt sich in seinem Roman "Die Familie" seine Herkunft zusammen und bringt dabei alles ins Rutschen.
Es geht los. Der Bagger fährt an der Firmenmauer entlang, dann hält er vor dem Eingangstor. Ein Mann steigt aus, schließt das Tor auf und schiebt es zur Seite. Er wartet einen Moment, blickt auf das Grundstück, steigt wieder ein. Langsam rollt der Bagger auf die Mühle zu, die im Weg stehenden Bäume räumt er ab. Ein paar Mal fährt er um das Gebäude herum, kommt an der Hinterwand zum Halt, fährt ein Stück näher heran, hebt die Schaufel - und lässt sie in die Wand krachen. Bevor er sich an die andere Seite macht, bringt er das Dach zum Einsturz, und so sind nach einer knappen halben Stunde von dem ältesten Gebäude des Stadtteils noch zwei Wände übrig. Gegenüber, wo vier Personen das Geschehen heimlich beobachten, zieht die Mutter die Gardine vor das Fenster.
Der Abriss einer unter Denkmalschutz stehenden Mühle unter den Augen ihrer Eigentümer wirkt in Andreas Maiers neuem Roman über weite Strecken wie das zentrale Motiv seiner "unter Dekonstruktionsgebot" stehenden Familie. Maier, der sich in seinem auf elf Teile angelegten Romanzyklus "Ortsumgehung" zuerst dem "Zimmer", von dort dem "Haus", der "Straße", dem "Ort", "Kreis" und schließlich der "Universität" genähert hat, geht in "Die Familie" noch einmal zu seinem Ursprung.
Er erzählt die Geschichte seiner Vorfahren Boll, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Wetterau kamen und zur bedeutendsten Familie am Usa-Ufer wurden. Von der Gründung des Steinmetzbetriebes, dem Haus mit seinem Garten voller Obstbäume und dem Aufwachsen in den sechziger und siebziger Jahren der Bundesrepublik. Zu Hause grassiert der Hass auf die "Baader-Meinhof-Bande", ganz so als handele es sich um persönliche Feinde. "Sie wollten uns ans Eigentum, denn sie waren Kommunisten, und beabsichtigten uns am Ende wohl auch zu töten." Ruhe tritt vor dem Fernseher ein, bei Kulenkampff und "Dalli Dalli", dessen Moderator Hans Rosenthal in den Augen der Großmutter "zwar en Jutt iss", aber sympathisch. Der Vater ist Anwalt, vor allem aber CDU-Lokalgröße. Wenn in Friedberg oder Bad Nauheim Wahlen stattfinden, fährt er nachmittags die Wahlbüros ab, um in den Verzeichnissen Verwandte aufzuspüren, die noch nicht gewählt haben, sie anschließend abzuholen und höchstpersönlich zur Urne zu kutschieren.
Noch hat der Erzähler seine kindlichen Koordinaten fest beisammen, alle Figuren erfüllen ihre Rollen. Zum Beispiel Onkel Heinz mit seiner "als Unsicherheitsfaktor" geltenden Frau Dörte, einer Dänin, der "einfach so und ohne jeden Grund" einhunderttausend Mark fordert. "Er war ja verrückt." Und Onkel J., "der Geburtsbehinderte, dem seine an den Kopf angesetzte Zange zeitlebens die heile Welt verhindert hatte, auch wenn er sich zur Hälfte seines Wesens in einer solchen gefühlt haben mochte." In angenehm trockenem Ton führt der Autor in die festgefahrenen Verhältnisse ein.
Die Erinnerungen führen Maier, der auch außerhalb seiner Bücher nicht müde wird, die eigene Herkunft hervorzuheben, zurück. "Alles, was ich auf diesem Gelände erlebte, hatte für mich mythische Züge und kam mir vielfach vergrößert vor." Ehe man fragen will: Wie sonst erlebt man Kindheit?, gerät hier alles ins Rutschen.
Es beginnt beim Grundstück. Unter dem Streit der Erben verkommt es zu einem "Sperrgebiet", vom Idyll ist kaum mehr etwas übrig. Noch im Federballspiel wird das Seil auf der Grenze der umstrittenen Parzellen gespannt - der Onkel auf der einen, der Vater auf der "Rest-Boll-Seite". Die Sache eskaliert, als der Denkmalschutz eine Sanierung der Mühle fordert, deren Kosten das Grundstück bald unverkäuflich und den Erbstreit unauflösbar zu machen drohen. Der Vater lässt den Bagger kommen.
Wie sich später herausstellt, ist der Abriss nur Sinnbild eines größeren Niedergangs. Für sich genommen verkörpert er die Sprachlosigkeit einer Familie. Eine Erklärung für das, was die Eltern nur "das Geschehen" nennen, bekommen die Kinder nicht. Als der Radikallösung ein millionenschweres Bußgeld und zwölf Jahre Rechtsstreit folgen, herrscht in der Familie bald nur noch Zerfall. Im Bett dämmert die Mutter vor sich hin. "Das Schweigen des Clans nach außen. Das nach innen alles zersetzt", macht sich breit. Zwei Geschwister haben sich schon abgewandt. Noch spürt der Leser nur, dass etwas wabert.
"Was traust du unserer Familie eigentlich zu?", fragt der ältere Bruder den Erzähler in einer Schlüsselszene und gibt selbst die Antwort: "Es ist in einer Familie wie unserer völlig egal, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Es ist egal, wie es vorkommt (...) Eigene Augen sind keine Kategorie." Allmählich lösen sich auch für den Erzähler die Schablonen, etwa die von seinem Vater. "Diese Schablone, die ihm, den ich seit einer Ewigkeit, nämlich seit dem Beginn meines Lebens kannte, zum Verwechseln ähnlich war (...) Eine Art Doppelgänger, optisch meinem Vater vollkommen gleich, aber zu einem völlig anderen Zweck geschaffen. Ein Avatar."
Die Vorstellung von der eigenen Identität zerfällt vollends, als sich ein wesentlicher Teil der Bollschen Erzählung als "Sage" entpuppt und die Herkunft allen Wohlstands erschüttert wird. Das bis dahin vor allem sehr komische Buch entwickelt jetzt eine ganz neue literarische Kraft.
Der Autor beginnt noch einmal; "ganz von vorn" puzzelt er sich seine Herkunft zusammen. Bilder, die man für unterhaltsam, aber auch überstrapaziert halten mochte, entlarvt Maier nun selbst: "Meine schöne Wetterau! Die ganze Zeit konnte sie Literatur sein. Sie konnte blühen, duften, schweben, fliegen." Die kindlichen Urszenen, alles erscheint in neuem Licht. Er, das "Kind der Schweigekinder", stellt fest: "Ich schreibe die ganze Zeit Nachkriegsliteratur, ohne es zu merken." Spätestens im Epilog wird deutlich, wie klug er dabei vorgegangen ist.
MARLENE GRUNERT
Andreas Maier:
"Die Familie". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 166 S., geb. 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main