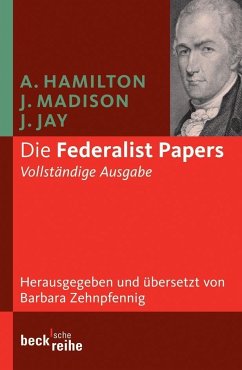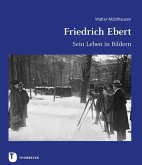Die Federalist Papers gehören zu den bedeutendsten Texten der modernen westlichen Demokratie. Die fünfundachtzig Artikel, welche 1787/88 erschienen und die zur Abstimmung anstehende amerikanische Verfassung verteidigten, diskutieren die Fundamente repräsentativer Demokratie und sind gleichsam als Gründungsdokumente heutiger pluralistischer Gesellschaften zu lesen. Ihre Aussagekraft ist von zeitloser Aktualität - sowohl vor dem Hintergrund der Legitimätskrise westlicher Demokratien wie angesichts der weltpolitischen Rolle der Vereinigten Staaten. Barbara Zehnpfennigs vielgerühmte Übersetzung liegt nun erstmals in einer preiswerten Ausgabe vor.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Johan Schloemann begrüßt diese "wohlfeile Taschenbuchausgabe" der "Federalist Papers" von Alexander Hamilton, James Madison und John Jay in der Übersetzung von Barbara Zehnpfennig. Er zählt die Autoren zu den amerikanischen Gründungsvätern der modernen westlichen Demokratie. Besonders interessiert er sich für die Begründung des Repräsentationssystem durch James Madison. Anhand ausgewählter Zitate zeigt er auf, dass der Autor durch die Einführung der Wahl von Repräsentanten den schrankenlosen Einfluss des gemeinen Volks auf den Staat einzudämmen suchte. Deutlich wird Madinsons Vorstellung, der Repräsentant könne und solle vornehmer, gebildeter, besser und reicher sein als der Durchschnittsbürger.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH