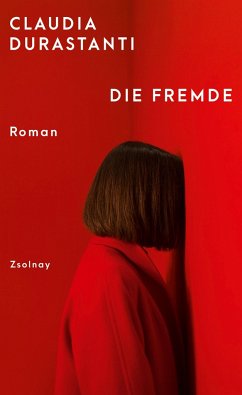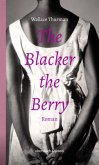"Claudia Durastantis Roman ist eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung." (Ocean Vuong) - Eine außergewöhnliche Familiengeschichte über das AndersseinClaudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia Durastanti einen außergewöhnlichen Roman gemacht. Von den euphorischen Geschichten einer wilden italoamerikanischen Familie in den Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Niklas Bender kann den autobiografischen Roman von Claudia Durastanti nicht vorbehaltlos empfehlen. Schön findet er, wie die Autorin die Geschichte ihrer Eltern, beide taub, beide Künstlerexistenzen zwischen Rom und Brooklyn, und ihre eigene Geschichte zwischen Genres und Zeiten wechselnd, mit Hang zu "kauzigen" Figuren und ironischem Ton erzählt. Die totale Begeisterung des Feuilletons angesichts des Buches aber möchte Bender dann doch nicht teilen. Allzu viele "Wohlfühlparolen" und missratene Metaphern prägen den Text, erklärt er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Makellosigkeit erweist sich nicht am Wohlgeschmack: Claudia Durastantis "Die Fremde"
Für sich genommen hat Claudia Durastanti einen schönen Text geschrieben, eine Autofiktion, denn "Die Fremde" erzählt ihr Leben und gibt sich zugleich als Roman zu erkennen. Der Titel zielt auf die Mutter beziehungsweise deren Taubheit und meint den ebenso tauben Vater mit. Eine Fremde in dieser Welt ist die Künstlerin jedenfalls, vor allem in der Jugend eine nächtliche Vagabundin; als Erwachsene ist sie selbst ihren Kindern nicht immer nah. Schließlich meint die Fremdheit den Ausländerstatus. Die italienische Familie lebt von den frühen achtziger Jahren an in Brooklyn.
Die Eltern sind ein unwahrscheinliches Paar: Da finden zwei Lebenskünstler zueinander, je nach Version dadurch, dass sie ihn vor dem Sprung in den Tiber gerettet (Mutter), oder dadurch, dass er sie vor einem Überfall bewahrt hat (Vater). Wie auch immer, sie lassen ihre bürgerlichen Jobs sausen und weigern sich fortan, die körperliche Einschränkung als Makel zu begreifen. Der Vater ist ein Gauner und Spieler, genau das scheint der Mutter zu liegen: "Einem Menschen, der die Behinderung nicht mit Mut oder Würde, sondern mit Leichtsinn meistern wollte", mag sie sich anvertrauen. Tatsächlich hatte sie vorher bereits eine abenteuerliche Existenz unter den Obdachlosen Roms geführt.
Durastanti geht nicht chronologisch vor, sondern gliedert ihren Roman in fünf thematische Abschnitte zu Familie, Reisen, Gesundheit, Arbeit und Geld sowie zur Liebe; sie schließt mit einer knappen Coda. Der mit Abstand längste Teil ist Reisen gewidmet: nach Amerika, Italien und England, jene Länder, in denen Durastanti gelebt hat oder noch lebt. Die Abfolge zeigt, dass die Chronologie durch die Hintertür wiederkehrt, denn sie entspricht den großen biographischen Stationen: Ziel der thematischen Anordnung ist nicht, die zeitliche Ordnung ganz zu zerschlagen, sondern Freiheit in der Form zu gewinnen.
Tatsächlich wechselt Durastanti elegant zwischen den Genres und Stilen, lässt Tableaus, Szenen, Dialoge mit essayhaften Reflexionen, Lektürefrüchten und Kunsterfahrungsberichten abwechseln - zentral ist der zur Installation "Synthetic Desert" von Doug Wheeler, deren schalltoter Raum Durastanti die akustische Situation der Eltern erschließt. Die stilistische Freiheit passt zu jener der Figuren. Das Paar bekommt ein erstes Kind, Durastantis Bruder, flüchtet aus ungenannten Gründen nach Brooklyn, wo die Großeltern mütterlicherseits leben und Durastanti 1984 geboren wird. Die Mutter arbeitet fortan nicht mehr, der Vater malocht in einer Baufirma. 1990 trennen sich die Eltern, Mutter und Kinder ziehen in die ländliche Basilicata, Italiens tiefsten Süden; der Vater zeigt sich nur noch episodisch. Die Mutter verliert sich in künstlerischen Projekten, durch ein Wunder verwahrlosen die Kinder nicht völlig. Zur Taubheit kommt das Stigma der Armut. Durastanti schafft es dennoch, die Schule zu beenden und Anthropologie zu studieren. Bei einer Kulturzeitschrift beginnt sie eine Intellektuellenlaufbahn.
Diese Aufstiegsgeschichte wimmelt von wilden Charakteren und Episoden, etwa die von der Geburt. Die Mutter muss operiert werden: "Stunden nach der Entbindung erschien mein Vater im Zimmer der Wöchnerinnen, ohne Blumenstrauß, aber mit einer Politesse am Arm, die ihm soeben ein Bußgeld verpasst hatte. Nachdem die beiden festgestellt hatten, dass sie sich wegen eines so banalen, absehbaren Vorfalls unmöglich scheiden lassen konnten, schlossen sie Frieden" - Durastantis Kindheit kann ihren Lauf nehmen. Der ironische Ton ist ein Markenzeichen des Romans, die Vorliebe für kauzige Charaktere ebenfalls. Beide zeigen sich nicht nur am Beispiel der Eltern, sondern auch beim Tarantella-Tanz vor Großvater Vincenzo im Keller, in der Schilderung der drogensüchtigen Cousine und in der eigenen Partnerwahl.
Neben der Ironie reklamiert Durastanti die Metapher für sich, zwei Verfahren, mit denen Gehörlose Schwierigkeiten haben, die Durastanti klug reflektiert. Die Ironie erlaubt es dem Roman paradoxerweise, die Eltern ernst zu nehmen, sowohl in ihrer Behinderung als auch in ihrer Zersetzungskraft: "Wie die Hunde meiner Mutter, die erst fügsam waren und in den letzten Jahren durchdrehten, passt sich alles, was meine Eltern berühren, ihrem Verfall an." Weniger überhöht klingen unangenehme Charakterzüge: "Meine Eltern sind glücklich, wenn sie ein verächtliches Erbarmen zeigen können." Die harten Worte stechen heraus, die Erzählerin hält meist eine wohlwollende Balance aus Nähe und Distanz, mit einem Lächeln ob der Absurdität des Lebens - eine ethisch und ästhetisch anspruchsvolle Haltung.
Wie gesagt, für sich genommen ist "Die Fremde" ein schöner Text: Hier könnte die Besprechung enden. Nun ist jedoch seit Erscheinen der Übersetzung eine Welle wohlig-schaudernder Bewunderung durch die Feuilletons gerauscht, man war bass erstaunt, hingerissen, lobte "den großen Wurf" - alles mit Emphase und Betroffenheit. Das gibt "Die Fremde" nicht ganz her. Die wohltarierte Ironie kippt ab und an in Zustimmung erheischende Wohlfühlparolen: "Was ist Behinderung in einer Familie, in der ohnehin jeder anders spricht?" Zum Kitsch solcher Sätze trägt der Stil bei, der betont schlicht schlichte Gefühle weckt. Oder auf Biegen und Brechen Metaphern platziert: "An einer Stelle benutzte er einen präzisen Begriff, finction, um etwas zu bezeichnen, was nicht vorgetäuscht, sondern konstruiert ist, ein Plankton, das auch auf meinen autobiografischen Heften im Dachboden wucherte." Gewagt und missraten. Ohne die (missverstandene) Etymologie von Fiktion diskutieren zu wollen: Plankton wächst eher (es können Tiere sein), und zwar im Meer - man fragt sich, wie es sich in (statt auf) Hefte auf dem (statt im) Dachboden verirrt hat.
Das sind viele weiche Stellen für einen einzigen Satz, und nicht alle gehen auf die Kappe der Übersetzerin. Es finden sich weitere Ausreißer in Emotion, Sprache oder Sache ("Doktor Frankenstein und Frankenstein selbst"), einige hätte das Lektorat glätten können. "Die Fremde" ist wie ein Apfel, der ein paar braune Stellen hat: Schneidet man sie aus, ist er ein Genuss, aber die Kunden, die ihn makellos finden, haben nicht aufgepasst.
NIKLAS BENDER
Claudia Durastanti: "Die Fremde". Roman.
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2021. 300 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Was für eine Geschichte! [...] Es ist ein Buch, das an nichts Großes oder Romanhaftes glaubt, weil es auf faszinierende Weise gar nicht anders kann, als die Details zu sehen. [...] In Die Fremde kann man schön sehen, wie sich der Kinderblick allmählich weitet und die Erzählerin zu dem wird, was auch die Autorin ist: eine brillante Analytikerin selbsterlebter Gegenwart." Paul Jandl, NZZ, 28.04.21 "Diesem grell leuchtenden Strom von Durastantis Erinnerungsarbeit kann man sich einfach nicht entziehen. Die heute 36-jährige Autorin beherrscht die stilistischen Register, die sie zieht, mit verblüffender Eleganz. Dank der charismatischen Titelfigur, deren Vorname bis zuletzt verschwiegen wird, sticht das Buch aus der langen Reihe autofiktionaler Publikationen heraus." Heinz Gorr, Bayern2-Favoriten, 27.04.21 "In ihrem Roman Die Fremde verwandelt sie krasse Kindheitserlebnisse in leuchtende Literatur. [...] Das alles liest man atemlos, hin- und hergerissen zwischen Fassungslosigkeit und Mitgefühl." Katja Nele Bode, Brigitte Woman, Mai 2021 "Wortmächtig erzählt die Autorin vom Leben der Familie über Kontinente hinweg. Ein zutiefst verstörendes Buch, passend zu einer Zeit, in der sich so viele fremd fühlen." Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel, 29.03.21 "Empathisch, aber ohne ihren Lesern Gefühle aufzuzwingen, intim, aber nie unangenehm privat, unsentimental und mit Humor. [...] eine Geschichte mit so außergewöhnlichen Protagonisten, wie man sie sich fast nicht ausdenken kann." Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14.03.21 "Von einer spröden Schönheit und selbstbewussten Eigenart." Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung, 10.03.21 "Durastanti springt von einem Gedanken zumnächsten, von der Poesie zur Prosa, von einer Überhöhung zu einer nüchternen Passage, als ob es unmöglich wäre, ihre Lebensgeschichte linear zu erzählen. Es gibt in diesem Buch unzählige Themen, die den Roman dicht werden lassen, an manchen Stellen sogar so sehr, dass man seine Gegenstände nicht in aller Tiefe erfassen kann." Francesca Polistina, Süddeutsche Zeitung, 09.03.21 "Ein sehr poetisches Buch." Jagoda Marinic, ZDF Das Literarische Quartett, 26.02.21 "Ein Text, der enorme Echtheit vermittelt." Juli Zeh, ZDF Das Literarische Quartett, 26.02.21 "In nahezu jedem Absatz gelingt es ihr, eine kleine literarische Welt zu erschaffen, die unter die Haut geht." Irene Prugger, Wiener Zeitung, 27.02.21 "Ein großer Wurf." Andrea Seibel, Literarische Welt, 27.02.21 "Dass Menschen auf verschiedene Weisen immer häufiger marginal bleiben und Nomaden werden, das macht das sehr lesenswerte Buch auch noch zu einem aktuellen Autodafé." Michael Freund, Standard Album, 20.02.21 "Egal ob italo-amerikanische Wohnviertel in Brooklyn, verlassene Dörfer in der Basilicata, oder die neue Heimat East-London, überall gelingen ihr überzeugende Milieustudien." Christine Gorny-Hansen, Radio Bremen Zwei, 17.02.21 "Eine junge literarische Stimme, die sich voll tobender Empathie und geistreicher Euphorie an den alten Themen abarbeitet, abarbeiten muss." Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 13.02.21