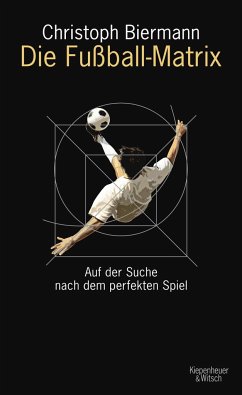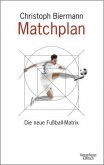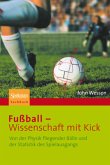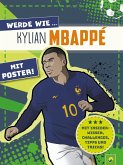Fußball im dritten Jahrtausend. Wo Meinung war, wird Wissen sein.
Christoph Biermann hat ein so außergewöhnliches wie verblüffendes Fußballbuch geschrieben. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel hat er mit Meistertrainer Felix Magath Fußball und Schach verglichen, ist in die Welt der Fußballdaten eingetaucht und hat das geheimnisvolle Laboratorium des AC Mailand besucht. Mit Lionel Messi hat er über Computerspiele gesprochen und einen Ökonom gefunden, der Fußball berechenbar machen will. Fußball ist das beste Spiel, weil es so einfach ist. Zugleich aber sind seine Möglichkeiten unerschöpflich und in den letzten Jahren immer weiter erforscht worden. Fußball hat seine digitale Wende erlebt und eine Invasion der Wissenschaftler. Das Spiel ist dadurch schneller geworden, taktisch anspruchsvoller und aufregender. Dieses Buch beschreibt den Stand der Dinge und dringt zugleich in die Grenzbereiche der neuen Fußballwissenschaft vor.Der Leser erfährt so, warum die wahre Fußballkunst in der Offensive liegt, und wie man sie am besten erlernt. Biermann erklärt, wie man einen Elfmeter schießen sollte, warum die Drei-Punkte-Regel den Fußball defensiver gemacht hat, und wie Klubs grobe Fehler bei Spielertransfers vermeiden können. Wir werden beim Lesen von überkommenen Meinungen Abschied nehmen müssen, aber in den allgegenwärtigen Diskussionen über Fußball smartere Antworten darauf geben können, wie es zu Sieg und Niederlage kommt. Christoph Biermann gehört schon lange zu den profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands. In seinen Artikeln und Büchern hat er den Lesern immer wieder neue Aspekte des Fußballs erklärt. Er beschäftigte sich mit der Welt der Fans, als diese noch abschätzig betrachtet wurden, und beschrieb die Entwicklung der Fußballtaktik, als »Viererkette« in Deutschland noch ein Kampfbegriff war. Auch »Die Fußball-Matrix« betritt wieder neues Terrain. Doch was heute noch teilweise wie Science Fiction klingt, wird schon bald überall im Fußball selbstverständlich sein.
Christoph Biermann hat ein so außergewöhnliches wie verblüffendes Fußballbuch geschrieben. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel hat er mit Meistertrainer Felix Magath Fußball und Schach verglichen, ist in die Welt der Fußballdaten eingetaucht und hat das geheimnisvolle Laboratorium des AC Mailand besucht. Mit Lionel Messi hat er über Computerspiele gesprochen und einen Ökonom gefunden, der Fußball berechenbar machen will. Fußball ist das beste Spiel, weil es so einfach ist. Zugleich aber sind seine Möglichkeiten unerschöpflich und in den letzten Jahren immer weiter erforscht worden. Fußball hat seine digitale Wende erlebt und eine Invasion der Wissenschaftler. Das Spiel ist dadurch schneller geworden, taktisch anspruchsvoller und aufregender. Dieses Buch beschreibt den Stand der Dinge und dringt zugleich in die Grenzbereiche der neuen Fußballwissenschaft vor.Der Leser erfährt so, warum die wahre Fußballkunst in der Offensive liegt, und wie man sie am besten erlernt. Biermann erklärt, wie man einen Elfmeter schießen sollte, warum die Drei-Punkte-Regel den Fußball defensiver gemacht hat, und wie Klubs grobe Fehler bei Spielertransfers vermeiden können. Wir werden beim Lesen von überkommenen Meinungen Abschied nehmen müssen, aber in den allgegenwärtigen Diskussionen über Fußball smartere Antworten darauf geben können, wie es zu Sieg und Niederlage kommt. Christoph Biermann gehört schon lange zu den profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands. In seinen Artikeln und Büchern hat er den Lesern immer wieder neue Aspekte des Fußballs erklärt. Er beschäftigte sich mit der Welt der Fans, als diese noch abschätzig betrachtet wurden, und beschrieb die Entwicklung der Fußballtaktik, als »Viererkette« in Deutschland noch ein Kampfbegriff war. Auch »Die Fußball-Matrix« betritt wieder neues Terrain. Doch was heute noch teilweise wie Science Fiction klingt, wird schon bald überall im Fußball selbstverständlich sein.

Christoph Biermann beschreibt in seinem Buch "Die Fußball-Matrix", wie die Digitalisierung das Spiel verändert hat, und er weiß auch, warum der Playstation-Messi besser spielt als der reale Messi
Auch wer sich nur mäßig für Fußball interessiert, wird davon gehört haben: Louis van Gaal, der neue Bayern-Trainer, hat ein Problem. Mit Franck Ribéry, seinem Star, der beim ersten Kurzeinsatz nach seiner Verletzungspause gleich zeigte, dass er nicht spielen will, was er spielen soll. Van Gaal sieht ihn als zentralen Spielgestalter in einer Mittelfeldraute, Ribéry sieht sich als freien Radikalen und zieht es vor, über links zu agieren. Ribéry stellt also die Systemfrage, welche zugleich eine Machtfrage ist. Er kann divenhaft auf seinem Standpunkt beharren, der sture Niederländer kann sich gewohnt autoritär geben - oder sein System entsprechend umstellen, was nicht ohne Gesichtsverlust abginge.
Der Konflikt ist nicht neu, die Älteren werden sich noch an das Duell Netzer vs. Weisweiler erinnern, aber die Mittel, über diesen Konflikt zu urteilen, haben sich seit Netzers Zeiten drastisch verändert, auch wenn dessen aktuelles Moderatoren-Ego das noch nicht begriffen hat. Man könnte zum Beispiel Daten sammeln, Daten zu Pässen, Zweikämpfen, Flanken, Laufverhalten, man könnte mit der entsprechenden Software die Vielfalt und Effizienz der Konstellationen vergleichen, die ein Team mit einem zentral und einem primär über links agierenden Ribéry hervorbringt. Das löste zwar die Machtfrage nicht, aber es objektivierte den Blick auf das Spiel.
"Wissensbasiert" nennt Christoph Biermann diese Perspektive in seinem Buch "Die Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel" - das Gegenmodell heißt "produktionsmittelbasiert", weil es sich weniger um wissenschaftlich gestützte Erkenntnisse kümmert und auf die individuelle Klasse der einzelnen Spieler setzt. Biermann ist kein Platoniker, er ist auch kein Science-Fiction-Autor. Die Matrix, die er meint, ist nichts, was das Spiel eisern im Griff hielte wie die Maschinen im gleichnamigen Film die Vorstellungswelt der Menschen; es gibt auch keine ewige Fußballidee, an der die jeweiligen Erscheinungsweisen des Spiels in unterschiedlichem Maße teilhätten.
Aber Biermann hat in seinem Buch, in das Artikel und Porträts der letzten Jahre eingeflossen sind, versucht, die Grundzüge der veränderten Fußballwelt zu beschreiben; jene Entwicklung, die Traditionalisten mit verächtlichem Unterton "Verwissenschaftlichung" nennen, wogegen sie dann wolkige Begriffe wie Kreativität, Spontaneität oder Spielwitz mobilisieren, welche dem Konzept- oder Systemfußball angeblich abhandenzukommen drohen.
Fußball ist längst zu einem "Spiel der Zahlen" geworden, von den Laktatwerten bis hin zur Ballbesitzstatistik, doch man sollte das nicht verwechseln mit den Milchmädchenrechnungen des Fernsehens, wenn der Kommentator düster raunt, Mainz 05 habe schon seit 17 Jahren nach einer Ecke von rechts kein Kopfballtor in Bochum mehr erzielen können.
Es geht um methodisch ausgefeilte Analysen, die auf der Digitalisierung beruhen, um riesige Datensätze, die das menschliche Auge gar nicht erheben könnte, und um die Schlüsse, welche gutbezahlte Experten daraus ziehen und für den Trainerstab einer Mannschaft zielgerichtet aufbereiten. Es geht darum, Meinungen, die es gerade im Fußball gibt wie Sand am Meer, durch Wissen zu ersetzen. Und das Erfrischende ist, dass Biermann sich bei seinen Exkursen nie fragt, ob das nun die Zukunft oder der Ruin des Fußballs sei.
Als langjähriger Fußballversteher bringt der 48-Jährige eine unverwüstliche theoretische Neugierde mit. Er schildert die Herkunft der Statistikspiele aus der Baseballwelt und erzählt auch von lustig-fatalen Irrtümern, wie dem des britischen Luftwaffenoffiziers, der glaubte, aus seinen aufwendigen Erhebungen zur Anzahl der Pässe, welche einem Tor vorausgehen, die Überlegenheit des Kick-and-Rush-Spiels herleiten zu können - wobei sich belegen lässt, dass der Mann seine Zahlen hartnäckig falsch interpretiert hat und wozu auch die kleine Pointe gehört, dass Mannschaften wie die norwegische Nationalelf der neunziger Jahre mit dem Kick-and-Rush-Stil durchaus befristet Erfolg haben konnten.
Manchmal ist es für den strukturkonservativen Fan auch leichter, über den Stadionrand hinauszuschauen. In die Kunst zum Beispiel, die latent zugleich eine Form des Wissens enthalten kann. Als Andreas Gursky bei der Europameisterschaft 2000 seine Kamera unter dem Dach des Amsterdamer Stadions installierte und seine beiden großformatigen (276 x 206 cm) Fotografien "EM Arena I und II" machte, zeigte er die Raumordnung des Spiels in einer Weise, welche die Optik der Taktikbildschirme vorwegnahm. Und als Harun Farocki bei der Documenta 2007 seine Installation "Deep Play" vorführte, in welcher auf zwölf Monitoren das WM-Finale 2006 durch das Raster verschiedener Software seziert wurde, erzählte er zugleich davon, dass die Digitalisierung dem Fußball zwar seine Unschuld genommen hat, aber auch zu einem unentbehrlichen Werkzeug geworden ist, um sein Funktionieren besser zu verstehen. Man erkennt diese Entwicklung leicht daran, welche Begriffe aus der Fachsprache sich längst im gemeinen Fußballdiskurs ganz selbstverständlich sedimentiert haben, von Ballbesitz und Viererkette bis zu One-Touch-Fußball, Automatismen und Spiel gegen den Ball.
Biermanns Buch folgt der plausiblen Arbeitshypothese, dass "jedes Geschäft eine Matrix hat", dass es also nachweisbare Muster gibt, Matrizen, die bestimmte Bewegungsgesetze und Mechanismen des Spiels ausmachen. Ihre Erforschung erlaubt nicht nur die Fehleranalyse, wie sie früher mühsam anhand von Videokassetten betrieben wurde, sondern erschließt ein Potential, das Spiel strategisch zu durchdringen und angemessene Trainingsmethoden zu entwickeln. Und zum Wunsch nach immer mehr Kontrolle gehören natürlich auch, wie ein dunkler Schatten, Wettbetrug, Bestechung und Doping, weil hier Steuerungsdrang und wirtschaftliche Interessen auf besondere Weise ineinandergreifen.
Weil es Biermann weniger um steile Thesen geht als um eine Bestandsaufnahme, bleibt auch offen, ob das Spiel womöglich doch zu komplex ist, zu sehr von Emergenzen, also unerwartet innerhalb eines Systems auftauchenden Situationen, geprägt ist, um es mathematisch in den Griff zu bekommen. Platonisch ausgedrückt: Die ontologische Differenz zwischen dem perfekten Spiel und seinen defizitären, von verspringenden Bällen und anderen kontingenten Umständen charakterisierten Erscheinungen ist viel zu groß, als dass man eines Tages eine perfekte Formel erwarten dürfte. Es ist zumindest so unwahrscheinlich wie der Anspruch der britischen Firma Epagogix, aus der mikroskopischen Zerlegung von Drehbüchern in Korrelation mit Einspielergebnissen die Formel für den perfekten Film zu entwickeln. Nichts illustriert diese Differenz treffender als die lakonische Antwort Lionel Messis, der bloß nickte, als Biermann ihn fragte, ob Messi, wenn er an der Playstation seinen Bildschirm-Avatar spielt, denn besser spiele als der reale Messi. Man muss jetzt also niemanden wie beim Zahnarzt beruhigen: Tut gar nicht weh! Es ist ja auch nicht so, dass die erhöhte Transparenz Fußball zum Scheinspiel gemacht hätte, das sich zu seiner bisherigen Gestalt verhielte wie Analogkäse zu echtem Käse. Die Lebenswelt des Fußballbetrachters, des Zuschauers im Stadion und vorm Bildschirm, hat sich auch nicht erst seit ein paar Jahren verändert; das Fernsehen und die kommerziellen Imperative haben das Spiel schon lange nach ihren Bedürfnissen zu formen versucht.
Bislang jedoch vertragen sich Stehplatzromantik und nüchterne Diagramme noch immer ganz gut. Und wie über Fußball, wie etwa über den Konflikt van Gaal vs. Ribéry, berichtet wird, daraus spricht noch immer der Wunsch, dass das Spiel und sein Umfeld sich am Ende in so etwas wie eine Erzählung verwandeln, in welcher die Dramaturgie, der Wunsch nach Tränen, Toren, Tragik und Rausch sich nicht einfach durch Punkte, Linien und Zahlen ersetzen lassen. Es ist diese "Neigung zu Instabilität und Chaos", wie Christoph Biermann das nennt, die ihn eher gelassen auf die schöne neue Fußballwelt schauen lässt. Und uns auch.
PETER KÖRTE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Jens-Christian Rabe empfiehlt den Sportjournalisten Christoph Biermann als einen der anerkanntesten im Land, und von dessen neuem Buch glaubt der Rezensent, dass selten "radikaler und zugleich zugänglicher" für eine neue Sichtweise auf den Fußball plädiert worden ist. Biermann hat mit Trainern, Medizinern, Software-Entwicklern und Wettbüro-Betreibern gesprochen und unzähligen Statistiken ausgewertet und kann jetzt sämtliche liebgewonnenen Fußballweisheiten widerlegen, frohlockt Rabe: Es gewinnt überhaupt nicht die Mannschaft das Spiel, die auch die meisten Zweikämpfe gewinnen, ausschlaggebend ist nicht der Ballbesitz, und es gibt auch keinen psychologisch günstigen Zeitpunkt. Worauf dagegen die Wettbüros achten, das sei, wieviel kleine, mittlere und große Torchancen es in einem Spiel gegeben hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Dem Sportjournalisten gelingt es, den modernen Fußball zu entschlüsseln, ohne den Sport zu entzaubern.« Tilmann P. Gangloff Südkurier 20200227