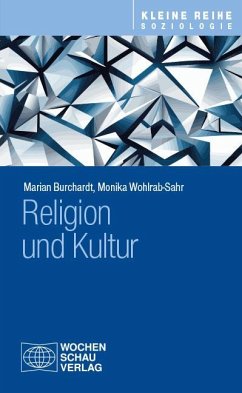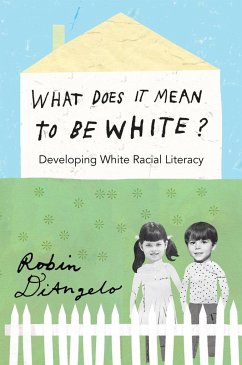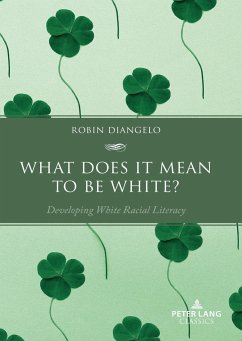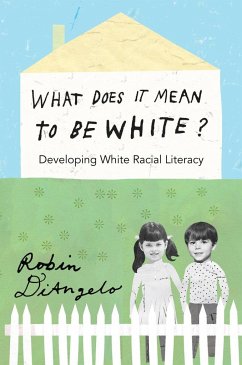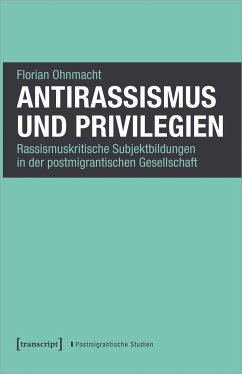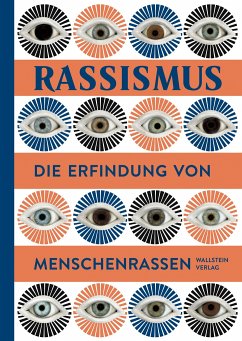Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Frank Böckelmanns Aufsehen erregende Studie über die gegenseitige Wahrnehmung und Fremdheit von Gelben", "Schwarzen" und "Weißen" ist 1998 in Hans Magnus Enzensbergers Die Andere Bibliothek erschienen, war lange Zeit vergriffen und liegt nun in einer erweiterten Neuausgabe - mit Stellungnahme des Autors zur gegenwärtigen Lage - endlich wieder vor. An Aktualität und Überzeugungskraft hat sie nichts eingebüßt - im Gegenteil. Schon vor zwei Jahrzehnten war die öffentliche Belehrung, wie man mit Fremden korrekt umzugehen habe, von einem entlarvenden Widerspruch geprägt: Mit der Parole "g...
Frank Böckelmanns Aufsehen erregende Studie über die gegenseitige Wahrnehmung und Fremdheit von Gelben", "Schwarzen" und "Weißen" ist 1998 in Hans Magnus Enzensbergers Die Andere Bibliothek erschienen, war lange Zeit vergriffen und liegt nun in einer erweiterten Neuausgabe - mit Stellungnahme des Autors zur gegenwärtigen Lage - endlich wieder vor. An Aktualität und Überzeugungskraft hat sie nichts eingebüßt - im Gegenteil. Schon vor zwei Jahrzehnten war die öffentliche Belehrung, wie man mit Fremden korrekt umzugehen habe, von einem entlarvenden Widerspruch geprägt: Mit der Parole "gegen Ausgrenzung" wurden wir dazu ermahnt, Fremdheit zu ertragen und sie zu beseitigen: einzusehen, daß die Fremden gar nicht fremd sind. Heute ist aus der Hemmung, den Menschen ins Gesicht zu sehen und für den Anblick Worte zu finden, eine regelrechte Wahrnehmungsblockade geworden, der allgegenwärtige Rassismus-Verdacht. Aber Gesichtsform und Hautfarbe, Gangart und Gestik, Blickverhalten und Mienenspiel gehören zum kulturellen Erbe der Kontinente. Sie sind nicht belanglos, weil die genetischen Unterschiede gering sind. Wenn heute unablässig gefordert wird, "das Fremde" zu tolerieren, wenn Transparente vor öffentlichen Gebäuden zur Weltoffenheit auffordern und die Mannschaftskapitäne in den Stadien die "Respekt"-Litanei vortragen, tritt das Ziel solcher Humanitätsbeschwörung zutage: die Beseitigung der Andersheit, vorab der eigenen. Doch dieser Versuch - auch diese Erkenntnis vermittelt Böckelmanns Buch - ist zum Scheitern verurteilt. Die zunehmende Unfähigkeit zur Befremdung geht einher mit einer Zunahme sprachloser Fremdheitserfahrungen. Hinter der eingeübten Aufgeschlossenheit beginnt das Wirkliche, das Unvergleichliche, heillos anstößig zu werden. Böckelmann zeigt die Europäer bzw. die Weißen als die Fremden der Anderen, als ihrerseits rätselhafte und undurchdringliche Wesen. Fremdheit - Abstoßung und Faszination - erweist sich nicht als Folge bedauerlicher Vorurteile, sondern als Ausdruck einer jeweils einzigartigen Begegnungsgeschichte. Dieses Buch ist keine Sammlung von Schuldzuweisungen, sondern ein Lob der Fremdheit.