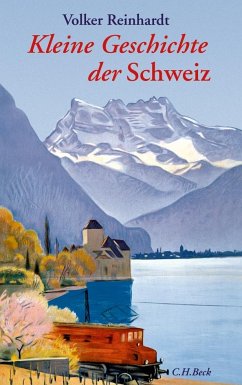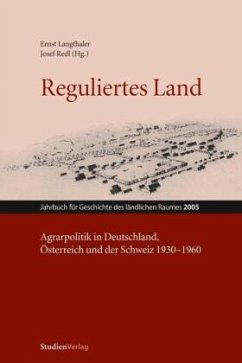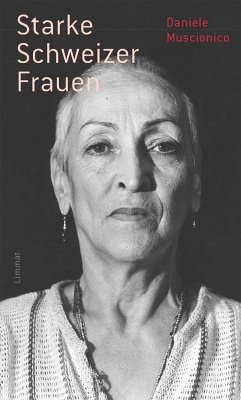Die Geschichte der Schweiz
Von den Anfängen bis heute

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Volker Reinhardts lange erwartete große Geschichte der Schweiz verbindet auf eindrucksvolle Weise die politische Entwicklung der Eidgenössischen Konföderation mit der Geschichte ihrer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. So entsteht ein einzigartiges historisches Panorama von der Antike bis heute. Kein anderes Land ist so vielfältig wie die Schweiz: Auf kleinstem Raum zählt man 26 Kantone mit weitgehender Autonomie, 4 Amtssprachen, 2 Konfessionen sowie unterschiedliche Klimazonen.Volker Reinhardt geht der Frage nach, wie es zu der Konföderation von so unterschiedlichen Gebieten kommen ko...
Volker Reinhardts lange erwartete große Geschichte der Schweiz verbindet auf eindrucksvolle Weise die politische Entwicklung der Eidgenössischen Konföderation mit der Geschichte ihrer Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. So entsteht ein einzigartiges historisches Panorama von der Antike bis heute. Kein anderes Land ist so vielfältig wie die Schweiz: Auf kleinstem Raum zählt man 26 Kantone mit weitgehender Autonomie, 4 Amtssprachen, 2 Konfessionen sowie unterschiedliche Klimazonen.
Volker Reinhardt geht der Frage nach, wie es zu der Konföderation von so unterschiedlichen Gebieten kommen konnte und warum diese trotz dauernder Kriege ein gemeinsames historisches Bewusstsein ausgebildet haben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Kultur. Zwingli und Calvin, Rousseau und Pestalozzi, Max Frisch, Alberto Giacometti und viele andere Schweizer Künstler und Intellektuelle haben weit über die Landesgrenzen hinaus gewirkt. Die Schweiz ist ebenso bodenständig wie weltoffen: Gerade dieseSpannung, so zeigt das Buch, macht Erfolg und Faszination des Landes aus.
Volker Reinhardt geht der Frage nach, wie es zu der Konföderation von so unterschiedlichen Gebieten kommen konnte und warum diese trotz dauernder Kriege ein gemeinsames historisches Bewusstsein ausgebildet haben. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Kultur. Zwingli und Calvin, Rousseau und Pestalozzi, Max Frisch, Alberto Giacometti und viele andere Schweizer Künstler und Intellektuelle haben weit über die Landesgrenzen hinaus gewirkt. Die Schweiz ist ebenso bodenständig wie weltoffen: Gerade dieseSpannung, so zeigt das Buch, macht Erfolg und Faszination des Landes aus.