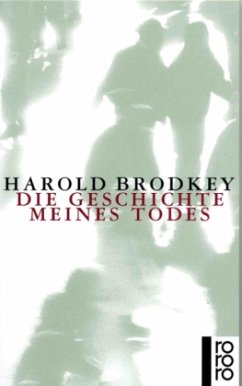Im Frühjahr 1993 wurde Harold Brodkey wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Bluttest ergab die überraschende Diagnose: Aids. Die Nachricht erfüllte Brodkey mit Verzweiflung, doch zugleich fühlte er sich seltsam klar, nüchtern, zu Scherzen aufgelegt und nachgerade unanständig amüsiert angesichts der Ironie, auf eine so häßliche Weise zu sterben. Seine schauspielerische Intuition sagte ihm, er sei in dieser Rolle falsch besetzt.
Doch langsam wurde ihm die schreckliche Wahrheit bewußt. Unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Klinik begann er zu protokollieren, wie die tödliche Krankheit sein Leben veränderte, was sie seinem Körper, seinem Geist, seiner Frau und seinen Freunden antat. Diese Arbeit setzte er bis zu seinem Tod fort. Das so entstandene Buch ist Tagebuch, Essay und autobiographische Erinnerung und es ist in jeder Hinsicht ebenso freimütig und luzide wie Brodkeys Romane. Brodkey spricht offen über das Tabu Aids, über die gesellschaftliche Rolle der Sexualität heute, aber auch über seine sexuelle Ambivalenz, über seine erotischen Erfah rungen in der New Yorker Künstlerszene und über die inzestuöse Beziehung zu seinem Stiefvater. Und er zeigt, wie er zu dem Ruf kam, ein "gesichtsloser Mensch", ein "Spiegel für die anderen" zu sein. Diese außergewöhnliche Fähigkeit widerzuspiegeln, was er in der Seele anderer Menschen fand, zeichnet sein Werk aus und tragischerweise führte ebendiese Fähigkeit letztlich zu seiner Infektion mit dem Virus.
Doch langsam wurde ihm die schreckliche Wahrheit bewußt. Unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Klinik begann er zu protokollieren, wie die tödliche Krankheit sein Leben veränderte, was sie seinem Körper, seinem Geist, seiner Frau und seinen Freunden antat. Diese Arbeit setzte er bis zu seinem Tod fort. Das so entstandene Buch ist Tagebuch, Essay und autobiographische Erinnerung und es ist in jeder Hinsicht ebenso freimütig und luzide wie Brodkeys Romane. Brodkey spricht offen über das Tabu Aids, über die gesellschaftliche Rolle der Sexualität heute, aber auch über seine sexuelle Ambivalenz, über seine erotischen Erfah rungen in der New Yorker Künstlerszene und über die inzestuöse Beziehung zu seinem Stiefvater. Und er zeigt, wie er zu dem Ruf kam, ein "gesichtsloser Mensch", ein "Spiegel für die anderen" zu sein. Diese außergewöhnliche Fähigkeit widerzuspiegeln, was er in der Seele anderer Menschen fand, zeichnet sein Werk aus und tragischerweise führte ebendiese Fähigkeit letztlich zu seiner Infektion mit dem Virus.

Was ein Mensch erlebt, wenn seine Tage gezählt sind: Harold Brodkey schreibt die Geschichte seines Sterbens / Von Paul Ingendaay
Es gibt einen Augenblick, der die gesamte Existenz in ein Vorher und ein Nachher einteilt, wenn alle Zähler auf Null gestellt werden. Für den amerikanischen Schriftsteller Harold Brodkey kommt dieser Augenblick im Frühjahr 1993, als er mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht wird. Er ist zweiundsechzig Jahre alt. Später erinnert er sich, daß ihm Bekannte schon seit langem gesagt haben, er sei auffallend mager. Der Arzt empfiehlt einen Bluttest, da Verdacht auf Aids bestehe. Der Verdacht bestätigt sich. "So endete mein Leben", heißt es in Brodkeys nachgelassenem Buch. "Und mein Sterben begann."
Dem Tod ins Gesicht sehen: Das Rätselhafte dieser Wendung ist, daß man sich vorstellt, er habe eine Physiognomie. Noch rätselhafter ist es, sich vorzustellen, sie wechsele von Tag zu Tag und man müsse beim Blick auf dieses Gegenüber auf Überraschungen gefaßt sein. Harold Brodkeys Buch "Die Geschichte meines Todes" erzählt, was ein Mensch sieht, wenn er nur noch eine eng begrenzte Zeit zu leben hat. Er sieht den Tod tatsächlich, überall, zu jeder Stunde. "Oft tue ich lange nichts", schreibt Brodkey. "Ich liege im Bett oder auf der Veranda. Ich starre zum Tod hin, und der Tod starrt mich an."
Zu anderen Zeiten wird der Sterbende übermütig, denn es ist einfach langweilig, krank zu sein, fast so, "als wäre man in einen Updike-Roman gezwängt". Die Augenblicksgeste ist alles - wieder einen Blick auf das Gegenüber getan, wieder bestanden. "Ich muß schon sagen, ich hatte vom Tod erwartet, er werde bedeutungsvoll glimmen, aber das tut er nicht. Er ist bloß da." Doch er hat kein Gesicht.
Harold Brodkey stirbt am 26. Januar 1996. Zweieinhalb Jahre zuvor hat er die Aids-Erkrankung in einem Essay im "New Yorker" bekanntgegeben. Seine homosexuellen Abenteuer, schreibt er, lägen ziemlich weit zurück, und mit jedem Jahr, das ihn von diesem Lebensabschnitt entfernte, sei die Gewißheit gewachsen, nicht infiziert worden zu sein. Nun, er habe sich geirrt. Jetzt liegt "Die Geschichte meines Todes" auf deutsch vor, 190 Seiten, aufgezeichnet in sieben Kapiteln über einen Zeitraum von über zwei Jahren.
Das ist wenig für einen Schriftsteller, der kaum etwas anderes getan hat, als zu schreiben, und dessen literarischer Nachlaß rund 35000 Seiten umfassen soll. Brodkeys Bücher waren nie Bestseller. Tatsächlich sind sie monströs: in ihrer maßlosen Ich-Setzung, die an einen Whitman des späten zwanzigsten Jahrhunderts denken läßt, in ihrer Beschreibungsbeharrlichkeit und einer jedes Maß sprengenden Pedanterie. Die "Nahezu klassischen Stories" (deutsch 1990 und 1991), der Roman "Profane Freundschaft" (1994) und das 1300-Seiten-Opus "Die flüchtige Seele" (1995) reichten aus, ihn zum Genie und zum amerikanischen Proust auszurufen. Nirgendwo war Brodkey erfolgreicher als in Deutschland.
Es ist zwar schwierig, irgend jemanden zu finden, der die "Flüchtige Seele" wirklich gelesen hätte, doch die Kühnheit von Brodkeys Ästhetik bleibt davon unberührt. Der Roman ist ein Buch für die Ewigkeit, also für eine Zeit, wenn es keine Mittagspausen und Lieferfristen, keine Dämmerungen und Jahresurlaube mehr gibt. Solange dieses Reich noch nicht zu haben war, mußte Brodkey sich darauf beschränken, den erlebten Augenblick zu rekonstruieren und wie einen Ballon aufzupumpen - mit dem, was er hätte sein können, sollen und dürfen, aber am Ende vielleicht doch nicht war. Sein Thema war immer er selbst: die dürftigen Ereignisse seiner Jugend in der Provinz, die Adoption, die bedrängende Situation in einer Familie der unteren Mittelklasse, die mit dem hochbegabten Kind wenig anfangen konnte, der Neid der Halbschwester, die sexuelle Identität. Daß sein Werk sich dabei stetig verengte, in dieser Enge aber irritierend weitläufig wurde, so daß es nur noch wenige Leser erreichte, nahm der Autor gelassen in Kauf.
"Die Geschichte meines Todes" ist von anderem Stoff. Man muß das Buch nicht nur zu Brodkeys wichtigsten Werken rechnen, es ist vielleicht das einzige, das von vielen gelesen und verstanden werden kann. Denn es profitiert davon, daß das meiste über dieses Leben schon gesagt ist. Und es zeigt wie andere Bücher, in denen Schriftsteller vom Sterben schreiben - Rilkes "Malte Laurids Brigge", Peter Handkes "Wunschloses Unglück", Philip Roth' "Mein Leben als Sohn" -, daß der Blick aufs Ende zu Klarheit und Genauigkeit zwingt, denn alles andere wäre frivol.
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Dies ist kein Aids-Tagebuch, kein Mitleidsprotokoll und erst recht kein Aufruf zur Solidarität mit einer gesellschaftlichen Gruppe, die nur Ahnungslose noch als Randgruppe bezeichnen können. Natürlich gehört Brodkey in die bedrückend lange Liste prominenter Aids-Toter im amerikanischen (meist New Yorker) Kulturleben der letzten Jahre. Robert Mapplethorpe starb mit 42 Jahren. Keith Haring mit 31. Rudolf Nurejew mit 54. Michael Bennett mit 44. Zu schweigen von Aids-Opfern wie Michel Foucault oder Bruce Chatwin, deren Angehörige die Todesursache verschleierten, oder dem kubanischen Schriftsteller Reinaldo Arenas, der nach Bespitzelung und Inhaftierung aus seiner Heimat floh, um im New Yorker Exil zu sterben. Schon jetzt könnte man eine Kulturgeschichte der Wirkungen von Aids schreiben. Sie würde von verkümmerten Lebensläufen handeln, von halbgemalten Bildern, unfertigen Theaterstücken und Choreographien, von einer Halde nachgelassener Fragmente. Sie müßte die abgebrochenen Traditionslinien verzeichnen, die der Tod von Künstlern, Produzenten, Lehrern und kulturellen Vermittlern hinterlassen hat.
Im Unterschied zu vielen der Genannten wird Brodkey nicht mitten aus seiner Karriere gerissen. "Ich fand das Verhängnis erträglich", schreibt er mit der unkoketten Leichtigkeit, die für sein Buch typisch ist. "Ich möchte mich in dieser Sache nicht abwehrend bürgerlich verhalten, doch die Entscheidung, die ich traf, war eine bürgerliche und keineswegs rühmlich - zu versuchen, mit Aids zu leben, noch eine Weile damit weiterzuleben." Weiterleben bedeutet für ihn, unter den eigenen Bedingungen zu leben, soweit und solange es geht. Auch das unterscheidet Brodkeys Sterben vom Sterben vieler aidskranker Künstler: Er macht das Faktum öffentlich, vermeidet aber sowohl die Inszenierung als auch die künstlerische Ausbeutung zu Lebzeiten.
Sein Buch ist vor allem ein Selbstgespräch, darüber hinaus ein Drei-Personen-Stück, in dem auftreten: Brodkey selbst, seine Frau Ellen Schwamm, die ihn pflegt, und sein Arzt, der uns als "Barry" vorgestellt wird. Oder auch ein Vier-Personen-Stück: wenn man den Tod mitrechnet, und das wäre ganz im Sinne des Autors. Brodkey scheint seinem Ende im wörtlichen Sinne sehr nah zu sein: Er behandelt es intim, wie ein vertrautes Gegenüber, und auffallend ist, wie leicht die Perspektive des Schreibenden von einem "anderen" außerhalb seiner selbst auf die eigene Schwäche, auf den eigenen Körper und dann auf das eigene Bewußtsein hinübergleitet. "Der Tod streicht nicht mehr auf leisen Sohlen und mit sanfter Stimme ganz nah vorbei. Er steht im Flur. Die Schwäche überrollt mich nicht und weicht dann, sondern sie bleibt bei mir. Sie riecht abgestanden. Sie überflutet mich, füllt meine ganze Seele aus. Die Hülse, die meine Jugend, meine Stärke und mein Glück enthalten hat, ist leer und bebt ein wenig. Ein junger Fuchs, ein nervöser kleiner Vogel im Schatten, ein Sack verseuchten Bluts, eine zum Skelett abgemagerte, steif und still daliegende Gestalt: das ist mein Bewußtsein. Und wenn nur die Wünsche, die man flüsternd äußert, ernst genommen werden und einem räuberisches Mitleid erspart bleibt, ist es, wie wenn ein kleiner Vogel gefüttert wird. Barry und Ellen werden mich für eine Weile retten."
So klingt die Prosa, für die Brodkey gerühmt wird und die sich in seinem Sterbebuch häufiger findet als in seinen dickleibigen Romanen. Auch der Solipsismus des Autors erscheint hier in gebändigter Form, und man will schon an die beschwichtigende Kraft des Todes glauben, so selbstironisch und gelassen steckt der Kranke in seinen Decken. Gerade dann, scheint es, wenn er alles Recht hätte, nur noch an sich zu denken, denkt er mit besonderem Feingefühl an die anderen. Eine größere Zärtlichkeit, als Brodkey sie im Schreiben gegenüber seiner Frau Ellen zeigt, ist jedenfalls kaum denkbar, eben weil seine Ansprüche, seine Empfindlichkeit (die nicht der Krankheit entspringt) und seine Nörgelei jederzeit zu spüren sind.
Der erste Sieg des zum Sterben Verurteilten besteht darin, noch eine Weile am Leben zu bleiben. Dafür braucht er eine regelmäßige Atmung, mehr Kraft und ein besseres Blutbild. Gegen Ende der Krankenhausphase - sie nimmt die erste Hälfte des Buches ein - dringt Brodkey so ungeduldig auf seine Entlassung, daß er Barry zu jenen merkwürdig wattierten Prognosen zwingt, die anzeigen, daß der körperliche Verfall etwas anderes ist als das Sterben. "Jetzt habe ich zu meinem eigenen Leib die sonderbarste Beziehung, die man sich nur vorstellen kann", schreibt Brodkey; "mein Körper gleicht für mich einem verkrüppelten Kaninchen, das ich nicht streicheln mag, das ich vergesse, rechtzeitig zu füttern, mit dem zu spielen und das kennenzulernen mir die Zeit fehlt, ein nutzloses Kaninchen in einem Käfig, das freizulassen grausam wäre. Es kennt kein Gebet, mit dem es um sein Überleben bitten könnte."
In solchen Passagen, in denen Brodkey den metaphorischen Einfall Satz um Satz zu einem differenzierten Bild ausrollt, gewinnt das Literarische die Oberhand, und es ist gleichgültig, was der Kranke im dokumentarischen Sinne "erlebt". Solange er sein Ich noch spürt, sagt die Krankheit ihm, wer er ist.
Als Tolstois Iwan Iljitsch erfährt, daß sein Schwager ihn bereits für "so gut wie tot" hält, geht er in sein Zimmer und beginnt, über das soeben Gehörte und dann über seinen körperlichen Zustand nachzugrübeln. Er horcht in sich und verfällt schließlich auf eine Wanderniere, eine Bedrohung, die desto realer wird, je länger er über sie nachdenkt. Dann erhebt er sich, weil er nicht tatenlos bleiben will, und geht zu einem neuen Arzt. Der Historiker Philippe Ariès deutet die Stelle mit dem klugen Satz: Er, Iwan Iljitsch, "hält sich den Tod vom Leibe, indem er ihn mit der Krankheit maskiert".
Harold Brodkey dagegen schreibt: "Es war mir eine Erleichterung, die Krankheit maskenlos, den Tod offen gegenwärtig zu wissen." Kein Wort der Wut und des Aufbegehrens, wie man es etwa von Canetti kennt, auch kein Protest gegen ein schlecht eingerichtetes Universum. Es geht nicht um die philosophische Schulbuchweisheit, Leben bedeute Sterbenlernen; wohl aber darum, die Individualität zu wappnen, und deshalb steht das Buch in mancherlei Beziehung der frühscholastischen Rat-und Trostliteratur eines Boethius näher als den Aids-Büchern der Gegenwart. Zwei Sätze aus Boethius' "Consolatio", die im Kerker geschrieben wurde, während ihr Autor seiner Hinrichtung entgegensah, könnten Brodkey als Motto dienen: "Aber jede plötzliche Veränderung vollzieht sich nicht ohne eine gewisse Erregung des Geistes. So ist es gekommen, daß auch du ein Weilchen von deiner Ruhe abfielst."
Es wäre anmaßend, über Harold Brodkeys Sterben zu urteilen. Doch die Art seines Schreibens darüber läßt sich genau bezeichnen. Es ist kontemplativ, und es scheint dem Schreiber mehr Kraft zuzuführen, als es ihm in Form physischer Anstrengung nimmt. Zwar wird berichtet, Brodkey habe es als tröstlich empfunden, in der großen Gemeinschaft der Aids-Kranken zu sterben, doch sein Buch entrichtet dieser imaginären Gemeinschaft keinen Tribut. Auch medizinische Einzelheiten nehmen wenig Raum ein. Manchmal beschleicht den Leser das Gefühl, die schöne Metapher sei die einzige Trophäe, die sich vom Krankenbett aus noch vorzeigen läßt. "Man lebt mit den Gezeiten der Medikamente, ihrem fließenden Ein und Aus. Man unternimmt den Versuch, als Person in der Welt weiterzubestehen. Man lächelt Barry zu. Man lächelt Ellen zu. Man liegt ganz still."
Ansonsten das Minimum: Hier der Name eines neuen Präparats, das vorübergehend besser hilft als ein anderes. Dort ein paar lakonische Zeilen über die "Prozession der Pillen", die am Ende auf rund zwanzig Stück täglich anwächst. "Ich hatte keine klare Vorstellung von den mittleren Zonen des Sterbens und dem wahren Ausmaß der Erniedrigung", schreibt Brodkey, aber er behauptet die Erniedrigung nur, er stellt sie nicht dar, jedenfalls nicht "das wahre Ausmaß". Statt zu beobachten, wie Aids termitenhaft an seinem Körper nagt, hält er fest, wie der langsam herantretende Tod den Geist des Kranken verändert, seine Wahrnehmung narrt, wie frühere Gewißheiten zurückweichen und sich neu formieren müssen, um dem Ansturm des sicheren Sterbens zu begegnen. Besonders ruhig (weil er sie bereits auf Tausenden von Seiten abgehandelt hat) er-
Fortsetzung auf der folgenden Seite
innert er sich an seine Kindheit: daran, daß sein leiblicher Vater, ein Analphabet und kleiner Trödler, das zweijährige Kind für dreihundert Dollar an die Brodkeys verkauft haben soll; an den sexuellen Mißbrauch durch seinen Stiefvater; an den Krebstod der Stiefmutter.
Es heißt, Sterbende zögen es vor, ganz bei sich zu bleiben. Dennoch überrascht es, daß Brodkey kein einziges Buch erwähnt, das er in diesen zwei Jahren gelesen, keine Musik, die ihn abgelenkt oder getröstet hätte, keine Bilder, keine Kunst. Daß er mit Bach-Sonaten gegen seine Depressionen ankämpfte, wie es der beeindruckende Dokumentarfilm von Georg-Stefan Troller vor fünf Jahren gezeigt hat, ist eine Nachricht aus einer anderen Welt; die des Sterbenden hat kein Mobiliar, kaum Gewohnheiten, allenfalls einige Unternehmungen, die ein letztes Mal anstehen. Nach Venedig reisen, um an einem Buch zu arbeiten; den eigenen Geburtstag feiern. Darüber hinaus will Brodkey die Auseinandersetzung mit dem Sterben demonstrativ auf eigene Rechnung bestehen. Nur ein kleiner Hinweis auf drei berühmte Sterbeszenen der Literatur fällt, auf Tolstoi, Dostojewski und Proust.
Seit kurzem können wir eine dieser Szenen so lesen, wie sie das französische Publikum am 1. Januar 1921 in der "Nouvelle Revue Française" kennengelernt hat. Hanno Helbling und Christina Viragh haben die Vorabdrucke aus der "Suche nach der verlorenen Zeit" - Romanteile, die Proust, oft in geraffter Form, an Magazine gab, um zu Lebzeiten die Motive und die Architektur des Ganzen zumindest anzudeuten - zum erstenmal ins Deutsche übersetzt. Die wenigen Dutzend Seiten, die Krankheit und Tod der Großmutter des Erzählers schildern, sind für sich genommen ein Meisterwerk, nicht nur wegen der psychologischen Einblicke, die man bestürzend nennen darf, nicht nur wegen der Proustschen Komik, die sich verdichtet, je wahrnehmbarer der Tod in den Lampenschein tritt, sondern weil alle Beziehungen zwischen den Figuren nebeneinander dargestellt werden, als gäbe es ein gemeinsames Schicksal, auf das sie zutreiben. Tatsächlich hat Proust etwas Ähnliches im Sinn. Mit der furiosen Szene bereitet er seine Figuren auf das vor, was (für sie, nur für sie) dem Beginn einer neuen Epoche gleichkommt: auf die Zeit, wenn die Großmutter nicht mehr lebt.
Von allen Schriftstellern hat Proust vermutlich am besten begriffen, wieviel Zeit die Menschen damit verbringen, sich gegenseitig zu täuschen. Und niemand übertrifft ihn darin, sich in die Gesichter dieser zahllosen Täuschungen zu versenken, denn niemand bringt für sie so viel Verständnis auf. Die erste Täuschung in der Todesszene besteht darin, daß der Erzähler seiner Großmutter gegenüber seine Besorgnis verbirgt, nachdem sie auf den Champs-Elysées einen Schlaganfall erlitten hat. Die zweite Täuschung begeht der berühmte Professor E., der die Großmutter untersucht, während er darauf wartet, daß sein beschädigter Frack in Ordnung gebracht wird; nachdem er die Kranke eine Viertelstunde mit Anekdoten und Scherzen unterhalten hat, teilt er dem Erzähler unter vier Augen mit: "Ihre Großmutter ist verloren." Die dritte Täuschung (es ist übrigens sehr wohl möglich, daß die Numerierung nicht stimmt, weil Täuschung bei Proust in der Luft liegt, und wer wollte sie dort numerieren) geht auf das Konto der Kranken selbst, die gegenüber ihrer Tochter, der "Mama" des Erzählers, ihre Schwierigkeiten beim Sprechen geradezu schauspielerhaft kunstvoll verschleiert und leutselig sagt: "Du meinst wohl, eine Magenverstimmung sei nichts weiter Unangenehmes!"
Die nächste Täuschung folgt auf dem Fuße. "Da richteten sich", heißt es nun mit biblischem Ernst, "zum ersten Mal die Augen der Mutter mit aller Inständigkeit auf die meiner Großmutter, ohne das übrige Gesicht sehen zu wollen, und sie begann die Reihe jener falschen Schwüre, die wir nicht halten können, mit den Worten:
,Mama, du wirst bald gesund werden, deine Tochter steht dafür ein.'"
Und so nimmt das, was Olof Lagercrantz eine "Todeskomödie der gegenseitigen Rücksichtnahme" genannt hat, seinen komischen Lauf. Daß die Schmerzen der Großmutter immer stärker werden, spornt sie nur dazu an, die strategischen Anstrengungen zu verdoppeln: "wenn sie meinte, wir seien nicht im Zimmer, stieß sie Schreie aus: ,Ah! das ist furchtbar!', aber wenn sie dann meine Mutter sah, bot sie alle Kraft auf, um die Spuren des Leidens aus ihrem Gesicht zu verbannen, oder sie wiederholte im Gegenteil ihre Klagen und versah sie mit Erklärungen, welche denen, die wir gehört haben mochten, nachträglich einen anderen Sinn gaben:
,Ah! mein Kind, es ist furchtbar, bei diesem schönen Sonnenschein im Bett zu liegen, wenn man spazierengehen möchte, ich weine vor Wut über eure Vorschriften.'"
Man muß nichts von Prousts Leben wissen, um zu begreifen, wieviel Wahrheit, egal wessen Wahrheit, in dieser Szene steckt. Und man braucht Harold Brodkeys gewaltiges monomanisches Werk nicht zu kennen, um zu ahnen, daß eine parallele Szene in seinem Sterbebuch in gewisser Weise der Literatur angehört, eben weil sie an Proust erinnert. Nach langem Drängen ist Brodkey verfrüht aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seine Wahrheit ereilt ihn im Taxi, das ihn und Ellen nach Hause bringen soll, sich jedoch mühsam durch den stockenden Stadtverkehr schleppt. Der Kranke muß sich nicht nur willenlos durchschütteln lassen, er wird auch ohnmächtig, und als er wieder zu sich kommt, ärgert er sich darüber, daß er seine Kräfte falsch eingeschätzt hat. "Ich hatte keineswegs die Absicht, meinen Fehler zuzugeben. Wenigstens ein halbes dutzendmal sagte ich: ,Mann, das ist wunderbar, nicht mehr im Krankenhaus zu sein!'"
Furchtbar, wunderbar, es ist beides gelogen: unschuldig gelogen, es geht ja nur um den eigenen Tod. Und was diesen betrifft, beginnt für Brodkey erst jetzt, als er nach Hause kommt, die eigentliche Vorbereitung. Im Herbst 1995 ist es soweit: "Ich habe wieder zu sterben begonnen." Dem Buch bleiben noch zwölf Seiten. Wenn man es über lange Strecken als literarisches Werk lesen konnte, so teilen sich jetzt die Wege, weil die Literatur ihrem Gegenstand nicht in den Tod folgen kann.
Denn das Bild, das wir vom Sterbenden sehen, hängt davon ab, von wo aus der Tod ins Auge gefaßt wird. Prousts Erzähler beschreibt die sterbende Großmutter als Tier, "das sich ihr Haar aufgesetzt und sich in ihre Laken gelegt hatte und in seinen Krämpfen die Decken umherwarf". Wer sich jedoch selbst beschreibt, wie Brodkey, der macht sich nicht zum wilden, sondern zum wehrlosen Tier. Der verwandelt sich in ein verkrüppeltes Kaninchen oder in einen nervösen kleinen Vogel. Und während bei Proust die gestorbene Großmutter in den Augen des Erzählers wieder zum jungen Mädchen wird, dessen Wangen vor Hoffnung, Glück und Heiterkeit leuchten, "wie die Jahre sie nach und nach getilgt hatten", sprechen die letzten Seiten bei Brodkey von der Schwierigkeit, angesichts des Todes eine Identität zu wahren.
Das, sagt Harold Brodkey, habe er noch nie beschrieben gefunden, in keiner Todesszene der Literatur. Davon liest man aber auch nicht, sondern erlebt es. Ein einziges Mal.
Harold Brodkey: "Die Geschichte meines Todes". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Angela Praesent. Rowohlt Verlag, Reinbek 1996. 190 S., geb., 34,- DM.
Marcel Proust: "Der gewendete Tag". ,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit' in den Vorabdrucken. Herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Hanno Helbling und Christina Viragh. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996. 377 S., br., 24,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main