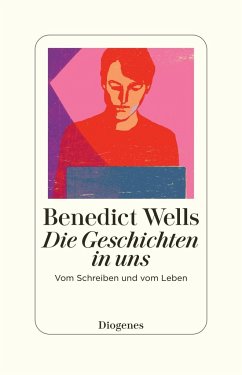Benedikt Wells - Die Geschichten in uns
Ein Blick hinter die Kulissen ist immer interessant, ob im Theater, im Film oder in der Buchbranche. So kann ein solches Buch, wie es der Bestsellerautor gerade frisch herausgebracht hat, nur fesseln und viele spannende Einblicke liefern.
Vor allem, weil
seine Person und seine Persönlichkeit eben auch sehr fesselnd sind, seine Geschichte, sein Hintergrund…mehrBenedikt Wells - Die Geschichten in uns
Ein Blick hinter die Kulissen ist immer interessant, ob im Theater, im Film oder in der Buchbranche. So kann ein solches Buch, wie es der Bestsellerautor gerade frisch herausgebracht hat, nur fesseln und viele spannende Einblicke liefern.
Vor allem, weil seine Person und seine Persönlichkeit eben auch sehr fesselnd sind, seine Geschichte, sein Hintergrund und insbesondere sein unglaublicher Erfolg, den er mit seinen Romanen erreicht.
Hier nun legt er also ein Art Biografie vor, er erzählt mit Charme und einiger Offenheit von seiner Kindheit und Jugend, den schwierigen Verhältnissen, den diversen Problemen seiner Eltern und von seiner Zeit in verschiedenen Internaten. Vor allem aber erzählt er von seinem Schreiben, wie es anfing, was es für ihn bedeutet und was er dafür investierte, an Zeit, Inbrunst, Disziplin, Verzweiflung und Freude, Emotion und Geduld.
Das liest sich für diejenigen, die selbst schreiben, noch mal doppelt so spannend, weil man erkennt, dass auch einem so erfolgsverwöhnten Schriftsteller auf dem Weg zu ebendiesem Erfolg nichts in den Schoß fällt. Gerade diesen Aspekt an seinem kurzen biografischen Ausflug mochte ich besonders, klang das für mich doch ehrlich und glaubhaft, so dass man sich sehr gut in ihn hineinfühlen kann. Man fühlt mit, wenn er seinen Text wieder und wieder ändert, wenn er leidet unter den immer wiederkehrenden Absagen, unter den mehr oder weniger wohlmeinenden Kritiken von Testlesern. Man bangt mit ihm, wenn er auf den Anruf seines Agenten wartet, hofft, dass es klappt mit dem Vertrag beim Verlag.
Benedict Wells wird so, in diesem Buch, menschlich, so dumm das hier auch klingen mag. Denn wie oft vergessen wir bei der Lektüre eines Buchs, welche Anstrengungen es den Autor, die Autorin gekostet hat, den Roman derart vollkommen zu machen.
So ist dieser erste Teil des Buchs in meinen Augen auch der bessere, der interessantere. Im zweiten Teil beschäftigt er sich mit all den Themen, die jeder Schreibratgeber aufgreift, zeigt die diversen Probleme und deren Lösungen an seinen eigenen Werken. Auch das ist durchaus interessant, aber vor allem eben nur in dieser Hinsicht. Denn er kann wenig Neues berichten, neue Tricks und Tipps geben, zumal er, wie er selbst schreibt, bis zum Verfassen dieses Buches keine Schreibratgeber las, dies aber nun, um sein eigenes Buch schreiben zu können, nachholte. Insbesondere bezieht er sich oft auf Stephen King und dessen hervorragendes Buch „Das Leben und das Schreiben“ – die Ähnlichkeit zum Untertitel bei Wells ist daher sicher kein Zufall.
Nach der Lektüre dieses Buchs lohnt es sich sicherlich, die Romane von Benedikt Wells noch einmal zu lesen. Man tut dies dann sicher mit anderen Augen.
Für alle, die sich für das Leben von Schriftstellern und ihr Schreiben interessieren, ein empfehlenswertes Buch, ebenso gut und fesselnd geschrieben wie die so erfolgreichen Romane dieses Autors.
Benedikt Wells - Die Geschichten in uns – Vom Schreiben und vom Leben
Diogenes, Juli 2024
Gebundene Ausgabe, 398 Seiten, 26,00 €