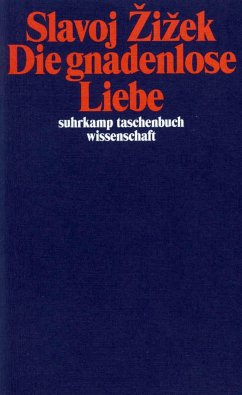In unserer vermeintlich säkularen Kultur ist die untergründige Struktur des Glaubens nach wie vor wirksam - wir glauben insgeheim alle. Jacques Lacan hatte recht mit der Behauptung, »Gott ist unbewußt« sei die einzig angemessene Formel des Atheismus. Die gnadenlose Liebe zeichnet die Konturen dieser unbewußten Glaubensvorstellungen nach, die unsere tägliche Erfahrung strukturieren: vom Gnostizismus, der der Cyberspace-Ideologie zugrunde liegt, über die verschiedenen Versionen asiatischer Spiritualität, die die perfekte ideologische Ergänzung zum globalen Kapitalismus darstellen, bis zur negativen Theologie des Judentums, die unter den kritischen Intellektuellen unserer Tage von der Frankfurter Schule bis zu den Dekonstruktivisten vorherrscht. All diesen vielfältigen religiösen Weltverständnissen versucht Die gnadenlose Liebe den »rationalen Kern« des Christentums entgegenzuhalten.

Mit Lacan und dem lieben Gott: Der Cineast Slavoj Zizek tanzt im Spiegelkabinett der Liebe
Der Autor ist ein passionierter Cineast, vermutlich weil das Kino das Blaue vom Himmel verspricht, ohne wirklich zu lügen. Und weil sich die wunderbare Welt der laufenden Bilder so schön auf die kahlen Wände postmoderner Gedankengebäude zurückprojizieren läßt. Slavoj Zizek, der Kinoliebhaber, hat nun ein etwas verwirrendes Buch über das Wesen der Liebe geschrieben. Natürlich voller Filmzitate, natürlich ganz im Geist und Jargon Lacans. Wie der Titel suggeriert ("Die gnadenlose Liebe"), geht es auch ein bißchen um Religion. Wer aber die Ankündigung für bare Münze nimmt, hier werde der "rationale Kern des Christentums" herausgearbeitet, mag sich am Ende getäuscht sehen. Während Zizek uns nämlich auffordert, "zu der dem Christentum zugrundeliegenden symbolischen Struktur" zurückzukehren, bekennt er sich gleichzeitig dazu, ein "altmodischer, bedingungsloser Atheist" zu sein. Ein derart paradoxer Appell an die Christlichkeit kann nun dies und das bedeuten. Vieles spricht allerdings dafür, daß Zizek den Tod Gottes zu einer Bedingung für Wert und Wahrheit der christlichen Überlieferung macht.
Eine kleine Anekdote, deren Absurdität mit theoretischem Ernst kaum beizukommen ist, stimmt den Leser auf diese Zumutung ein: Das Buch sei einem "anonymen Angehörigen des rumänischen Geheimdienstes" gewidmet. Erklärtermaßen wird bei Zizek der Slapstick zum Argument: Die Geschichte spielt nach dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes, der Diktator ist gestürzt, doch der Apparat der rumänischen Geheimpolizei bleibt voll funktionstüchtig. Man bemüht sich, den alten Strukturen einen demokratischeren Anstrich zu geben. In dieser Situation erhält ein amerikanischer Freund des Autors, der sich in Bukarest aufhält und dessen Telefon offensichtlich abgehört wird, einen sonderbaren Anruf. Jener namenlose Mitarbeiter des Geheimdienstes bedankt sich bei ihm in gebrochenem Englisch für all die freundlichen Worte, die er ihn am Telefon über Rumänien hat sagen hören.
Das totalitäre System als Sinnbild für den repressiven Charakter der Gnadenlehre, die Schuld durch Schuldgefühle ersetzt, der gestürzte Ceausescu als Statthalter des toten Gottes, der Anruf von der Abhörstation als Chiffre für die kommunikative Struktur der Offenbarung - ähnlich wie spätere Passagen des Buches, in denen sich Zizek ausdrücklich mit religiösen Fragen beschäftigt, verdankt die Parabel vom liebenswürdigen Geheimdienstoffizier ihre Plausibilität einem Tertium comparationis, nämlich der Psychoanalyse Lacans. Dessen Lehrformeln vom abwesenden großen und unerreichbaren kleinen anderen, seine Theorien der symbolischen Ordnung ohne Zentrum und des gänzlich phantasmatischen Liebesobjekts sind stets präsent. Sobald man die psychoanalytischen Untertitel einblendet, fügen sich die theoretischen Schnappschüsse Zizeks zu einer Art Bilderbogen zusammen. Da er ihren Lacanianischen Hintergrund aber schlecht ausleuchtet, fehlt es ihnen an Tiefenschärfe.
Man muß Zizeks lacangestützte Lust an der Tabuverletzung nicht gleich als Masche abtun. Sie ist gleichsam eine höherstufige Lust, eine Lust aus Prinzip. Und diesem Prinzip lohnt es sich durchaus auf die Schliche zu kommen. Doch die Erfahrung, daß der Text eigentlich nur "funktioniert", wenn man stillschweigend das sinngebende Raster ergänzt, nährt den Verdacht, das neue Thema (der christlichen Liebe) werde lediglich aufgegriffen, um alte Thesen zu illustrieren. Zizeks Beförderung der gemeinen christlichen Nächstenliebe zu einer sogenannten "gnadenlosen" Liebe scheint die um den berüchtigten Begriff der jouissance (des Genießens) kreisende Liebesmetaphysik des reifen Lacan ungefiltert in das religiöse Weltbild einspeisen zu wollen.
Das exzessive Genießen, das nach Lacan den Automatismus eines notwendig unbefriedigten Begehrens durchbricht und damit wie durch ein Wunder die Entfremdung unserer sprachlich vermittelten Lebensform aufzuheben vermag, wird eins zu eins abgebildet auf die Gottesliebe, die, nach Zizek Vorstellung, den kalkulierbaren (und schon allein deshalb kompromittierenden) Rahmen der Sittlichkeit sprenge. Da sich der hemmungslos Genießende ebenso wie der wahrhaft Gläubige für ein "Ding" verzehrten, das zwischen absoluter Rätselhaftigkeit und Nichtsein oszilliere, sei ihre Passion nichts anderes als ein amour fou, der helle Wahnsinn also.
Jetzt endlich versteht man, warum Zizek seine Kinoleidenschaft als Freizeitbeschäftigung kultivieren konnte, während sein theoretischer Eros kategorisch nach professioneller Befriedigung verlangte. Wird doch keine Filmvorführung jemals einen so abgründigen Schwindel erzeugen wie die unendlichen Weiten des Lacanianischen Spiegelkabinetts.
BETTINA ENGELS
Slavoj Zizek: "Die gnadenlose Liebe". Aus dem Englischen von Nicolaus G. Schneider. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. 188 S., br., 9,-
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Etwas verwirrend findet Rezensentin Bettina Engel Zizeks Buch über das Wesen der Liebe: "natürlich voller Filmzitate, natürlich ganz im Geist und Jargon Lacans". Schlüsselszene des Buchs ist Bettina Engel zufolge eine Episode, in deren Zentrum ein namenloser Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes nach dem Sturz von Diktator Ceaucescu steht. Zizek deutet das "totalitäre System als Sinnbild für den repressiven Charakter der Gnadenlehre", lesen wir also - eine Lehre, die Schuld durch Schuldgefühle ersetze. Hinter dieser Deutung, die hier nur unvollständig wiedergegeben ist, ortet die Rezensentin Lacans "Lehrformel vom abwesenden großen und unerreichbaren kleinen anderen". Zizeks Gedankenspiele sind für die Rezensentin augenscheinlich nicht ganz ohne Reiz. Prinzipiell erscheint ihr das Buch allerdings eher als ein Bilderbogen aus theoretischen Schnappschüssen. Da der Autor den lacanianischen Hintergrund der Bilder aber schlecht ausleuchte, fehle es ihnen an Tiefenschärfe.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH