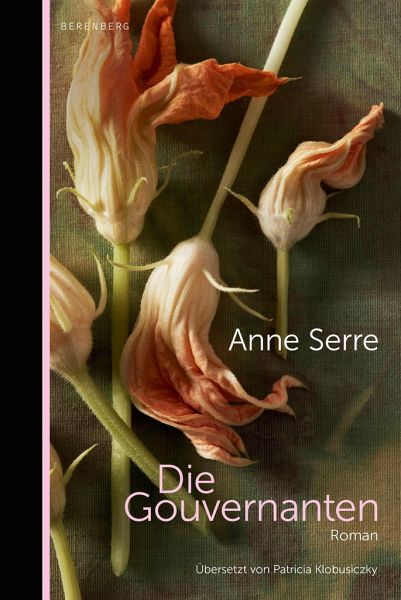Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Sie sind zu dritt, und in dieser abgeschiedenen Villa hinter hohen Bäumen sind sie die Königinnen: die Gouvernanten. Auf die Erziehung der ihnen anvertrauten Jungen geben sie wenig, lieber lassen sie sich melancholisch durch die hellen Tage treiben. Manchmal zieht es sie zum goldenen Tor, das ihr Reich be grenzt, wo sich, wild vor Verlangen, die Männerdrängeln. Erhört werden sie alle nicht, denn hier stellen die Gouvernanten die Regeln auf. Verliert sich aber ein Fremder in den Garten, gehen sie wie im Rausch auf die Jagd, richten den Ahnungslosen unerbittlich zu, mit Küssen und mit Biss...
Sie sind zu dritt, und in dieser abgeschiedenen Villa hinter hohen Bäumen sind sie die Königinnen: die Gouvernanten. Auf die Erziehung der ihnen anvertrauten Jungen geben sie wenig, lieber lassen sie sich melancholisch durch die hellen Tage treiben. Manchmal zieht es sie zum goldenen Tor, das ihr Reich be grenzt, wo sich, wild vor Verlangen, die Männerdrängeln. Erhört werden sie alle nicht, denn hier stellen die Gouvernanten die Regeln auf. Verliert sich aber ein Fremder in den Garten, gehen sie wie im Rausch auf die Jagd, richten den Ahnungslosen unerbittlich zu, mit Küssen und mit Bissen. Und all das vor den Augen des Nachbarn, der die angebeteten Frauen mit seinem Fernrohr auf Schritt und Tritt verfolgt... Mit Eleganz und dunkler Sinnlichkeit - und durchaus mit subtiler Komik - erzählt Anne Serre in diesem fantastischen Märchen von der Macht der Blicke und von weiblichem Begehren.
Anne Serre, geboren 1960 in Bordeaux, hat seit ihrem Romandebüt 1992 sechzehn Romane und Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Für 'Im Herzen eines goldenen Sommers', 2022 bei Berenberg erschienen, erhielt sie 2020 den Prix Goncourt de la Nouvelle. 'Die Gouvernanten' wird derzeit u. a. mit Lily-Rose Depp in Hollywood verfilmt.
Produktdetails
- Verlag: Berenberg Verlag GmbH
- Originaltitel: Les gouvernantes
- Seitenzahl: 92
- Erscheinungstermin: 25. August 2023
- Deutsch
- Abmessung: 203mm x 138mm x 12mm
- Gewicht: 174g
- ISBN-13: 9783949203671
- ISBN-10: 3949203672
- Artikelnr.: 67757153
Herstellerkennzeichnung
Berenberg Verlag
Sophienstraße 28/29
10178 Berlin
info@berenberg-verlag.de
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Einmal lesen ist nicht genug, so der restlos beglückte Rezensent Eberhard Rathgeb über Anne Serres Buch, das erstmals im Jahr 1992 erschienen war und nun endlich auf Deutsch vorliegt. Eine Geschichte wird darin nicht wirklich erzählt, erfahren wir, aber es geht um drei Gouvernanten, die von einem Ehepaar angestellt sind und auf deren wilde kleine Jungen aufpassen. Auch die Gouvernanten sind wild, fährt Rathgeb fort, sie ziehen sich gerne aus und toben durchs Gras, und wenn sich ein Mann, der ihnen gefällt, in ihre Nähe verirrt, kennen sie kein Halten mehr, ob er nun will oder nicht. Der Rezensent fühlt sich von Beginn an umfangen von einer romantischen Stimmung, in der sich das befremdliche Geschehen in einen weichen Zauberzustand auflöst. Es geht um das Aufblühen weiblicher Sexualität, so Rathgeb, Ahnungen sind da wichtiger als abschließende Erklärungen und eben deshalb ist diese Prosa für ihn so lebendig und gefühlsnah. Ganz besonders empfiehlt der Rezensent das Buch Paaren zur gemeinsamen Lektüre.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Dieser betörende und berauschende kleine Roman von Anne Serre, der 1992 in Frankreich erschien und glücklicherweise jetzt endlich übersetzt wurde, ist ein ganz seltenes poetisches Fundstück, und man kann nur hoffen, dass er herumgereicht und bestaunt wird, wie ein Bild, eine Fotografie, die jeden, der sie betrachtet, leicht und froh und nachdenklich stimmen wird.« Eberhard Rathgeb Die Zeit
Laura, Éléonore und Inès sind Gouvernanten im Dienst von Monsieur und Madame Austeur. An der Erziehung der Jungen haben sie allerdings kein Interesse, denn das echte Leben liegt ihnen mehr. Verirrt sich ein Fremder in den Park, wird er gejagt, erlegt, mit Haut und Haaren …
Mehr
Laura, Éléonore und Inès sind Gouvernanten im Dienst von Monsieur und Madame Austeur. An der Erziehung der Jungen haben sie allerdings kein Interesse, denn das echte Leben liegt ihnen mehr. Verirrt sich ein Fremder in den Park, wird er gejagt, erlegt, mit Haut und Haaren gefressen. Unersättlich sind sie, stellen Regeln auf und folgen ihrem Begehren.
„Nicht alle Fremden werden an einem Nachmittag verschlungen. Die Gouvernanten haben auch wahre Liebesbeziehungen, von längerer Dauer, mit Anfang, Höhepunkt und unabwendbarem Ende. Zuerst sprühen die Gouvernanten vor Freude. Zur Mitte hin spüren sie bereits die langen, feinen Nadeln des Leids. Wenn sie sich trennen, ist die Liebe längst vorbei.“ (Seite 37)
Mit einem Augenzwinkern zu genießen, sinnlich, düster, lebensbejahend und wild. Dieser Mix aus Märchen, Fantasy und poetischer Prosa hat mich angenehm überrascht, eine solche Erzählung war für mich neu. Fantastisch und mystisch, dabei aber nicht abgedreht, wird die weibliche Lust gefeiert, nehmen sich die Frauen, was ihnen gefällt. Einem Experiment gleich ließ ich mich drauf ein und wurde belohnt mit einer Geschichte, die mich verzaubert hat. Da ist es toll, dass sie verfilmt wird mit der Tochter eines berühmten Filmstars. Volle Punktzahl gibt es dafür von mir.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Ein Trompe-l’œil in Buchform
Sie sind wie kleine Vogerl, gefangen in einem goldenen Käfig. Doch wenn sich die goldene Tür zum Garten der Villa öffnet, gibt es für die Gouvernanten kein Halten mehr. Alle Sehnsüchte, wilden Fantasien und Gelüste …
Mehr
Ein Trompe-l’œil in Buchform
Sie sind wie kleine Vogerl, gefangen in einem goldenen Käfig. Doch wenn sich die goldene Tür zum Garten der Villa öffnet, gibt es für die Gouvernanten kein Halten mehr. Alle Sehnsüchte, wilden Fantasien und Gelüste drängen plötzlich wie ein wildes Tier nach draussen und lassen die jungen Frauen ihr gesittetes Dasein vergessen. Jeder Fremde, der ihnen begegnet, muss sich willenlos den Forderungen und Zärtlichkeiten ergeben. Aber die Gouvernanten sind nicht unter sich, sondern das Auge des Nachbarn ist immer allgegenwärtig...
"Die Gouvernanten" von Anne Serre ist ein Trompe-l’œil in Buchform, das sinnlich und ekstatisch zugleich ist, verführt und die Leser;innen zu Verbündeten des voyeuristischen Nachbarn macht. Serre hat eine sehr plastische Schreibweise, die aus einem altertümlich anmutenden Gemälde eine bewegte Szenerie werden lässt. Der feine Stoff der Stiefeletten glänzt in der Sonne, das verheißungsvolle Rascheln der Röcke klingt wie ein geflüstertes Versprechen nach mehr und die sinnliche Verführung spricht aus jedem Wort, das aus der Feder der Autorin fließt.
Serre ist eine Wortpoetin, die mit den heißen wilden Gedanken und Sehnsüchten der ansonsten so züchtigen und fast schon gelangweilt wirkenden Gouvernanten spielt, lässt erotische Fantasien aus den Seiten steigen und verwandelt ihr Gouvernanten in Sirenen. Auch spielt sie mit der Leserschaft, genauso wie die Gouvernanten mit den Männern spielen, setzt die weiblichen Reize gekonnt ein und kurbelt das Kopfkino mit erotischen Bildern ab.
Der träge heiße Sommertag lässt nicht nur die Hitze im Garten flirren, sondern kokettiert mit nackten Schenkeln, weichen Rundungen und liebreizenden Lippen, die immer wieder verführerisch locken.
Ein kleine Lustspiel mit dezenter Komik, ästhetischer Erotik und dem ein oder anderen Seitenhieb auf unsere Gesellschaft, die sich allzu leicht verführen lässt.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Feministisches Märchen
Der Debütroman der vielseitig tätigen, französischen Schriftstellerin Anne Serre, der 1992 in Frankreich von den Feuilletons als schwer einzuordnen angesehen wurde, kam erst 31 Jahre später nun endlich auch in deutscher Übersetzung heraus. Er …
Mehr
Feministisches Märchen
Der Debütroman der vielseitig tätigen, französischen Schriftstellerin Anne Serre, der 1992 in Frankreich von den Feuilletons als schwer einzuordnen angesehen wurde, kam erst 31 Jahre später nun endlich auch in deutscher Übersetzung heraus. Er wurde in den Buchkritiken hier als ein Roman voller Sprachlust gefeiert und als hoch willkommene Abwechselung von der aktuellen Schwemme autofiktionaler Prosa. Als ein Märchen für Erwachsene hat es die weibliche Selbstermächtigung zum Thema, zu der insbesondere auch die Sexualität gehört. Die wird in einer extrem selten anzutreffenden Weise und in einer geradezu federleichten, poetischen Sprache feinfühlig behandelt und immer wieder auch gefühlvoll mit Naturromantik durchmischt.
In dem hinter Bäumen versteckten, abgeschiedenen zweistöckigen Haus von Monsieur und Madame Austeur erfüllen die drei etwa gleichaltrigen Gouvernanten Eléonore, Laura und Inès ihre Erzieherinnen-Rolle mehr schlecht als recht. Sie betreuen eine zahlenmäßig nicht benannte Gruppe von «kleinen Jungen» in der stattlichen, von einem großen Park umgebenen und durch ein goldenes Tor von der Welt abgeschotteten Villa. Außerdem gibt es auch etliche Dienstmädchen im Figurenkabinett dieses feministischen Kurzromans, aber auch den greisen Nachbarn, der das Geschehen nebenan unermüdlich mit dem Fernrohr verfolgt, und außerdem einige Männer, die zufällig vorbeikommen. Die schönen Gouvernanten aber sind die wahren «Königinnen» in diesem Roman-Setting, sie genießen unangefochten alle Freiheiten. Man könne zu dem Schluss gelangen, heißt es an einer Stelle, «dass Monsieur und Madame Austeur sehr nachlässig waren, als sie so leichsinnige junge Damen einstellten».
Die ziehen sich nämlich oft exhibitionistisch aus, streifen dann nackt durch den Park, präsentieren sich gern ungeniert bei offenen Fenstern dem voyeuristischen greisen Nachbarn. Und so wird denn auch gleich zu Beginn der Geschichte ein «sehr schöner Mann» ihr Opfer, den sie zufällig im Park aufgreifen. In einem wilden sexuellen Rausch stürzen sie sich auf ihn: «Sie werden es ihm besorgen und dabei auf ihre Kosten kommen», heißt es da, und so geschieht es denn auch. Zwischen den vier Figuren-Gruppen Ehepaar Austeur, Gouvernanten, Dienstmädchen und kleine Jungen herrscht eine seltsame Eigendynamik, die zu wechselnden Beziehungen untereinander führt. Der Roman lässt vieles im Dunkeln, wobei Plausibilität wirklich kein Kriterium ist, auf das man sich verlassen könnte als Leser. Von der eigentlichen Arbeit der Gouvernanten als Erzieherinnen ist nie die Rede, obwohl es doch «einige Dutzend kleine Jungen» sind, die helfend herbeieilen, als beispielsweise eine Vase kaputt geht. Über die Eltern dieser vielen Kinder wird ebenfalls kein Wort verloren, sie sind scheinbar elternlos glücklich. Als Laura schwanger wird, ohne eine Idee davon zu haben, was denn da wie geschehen ist, - eine unbefleckte Empfängnis quasi -, ändert sich plötzlich der Fokus. All die Frauen fangen an, wie verrückt Sachen für das Baby zu stricken, sogar Madame Austeur ist im Baby-Fieber.
Es wird nicht wirklich eine Geschichte erzählt in diesem mystisch anmutenden Roman ohne Plot, er ist allenfalls als Coming-of-Age-Story anzusehen, die auf zauberhaft sinnliche Art das Aufblühen weiblicher Sexualität zum Thema hat. Das Ende besteht dann schließlich in einem märchenhaften Verschwinden der Gouvernanten. «Sie hatten beinahe das Gefühl, zu verschwinden», heißt es am Schluss, «Sie musterten sich gegenseitig, sahen sich in Spiegel prüfend an, wechselten fragende Blicke, ohne recht zu wissen, was sie eigentlich fragen wollten.» Das Geschehen endet mit der Feststellung von Eléonore «Wir gehen ein» und der Replik von Laura «Wir lösen uns auf». Es ist eine zutiefst romantische Stimmung, die einen beim Lesen sofort umfängt. Eine sprachmächtige, verführerische Poesie ersetzt hier konsequent alle Gewissheiten durch Ahnungen und öffnet als feministisches Märchen der Phantasie des Lesers sämtliche Grenzen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Voyeurististisch werden drei junge Frauen beobachtet, die im Dienst des Hofes Austeur für fordernde Jungen Dienst tun. Drei Gouvernantinnen, die durch das Anwesen Streifen, mal Allianz mit den Hausmädchen eingehen, mal mit Monsieur und Madame, sich dann wieder mit voller Hingabe den nach …
Mehr
Voyeurististisch werden drei junge Frauen beobachtet, die im Dienst des Hofes Austeur für fordernde Jungen Dienst tun. Drei Gouvernantinnen, die durch das Anwesen Streifen, mal Allianz mit den Hausmädchen eingehen, mal mit Monsieur und Madame, sich dann wieder mit voller Hingabe den nach Aufmerksamkeit und Devotion hungernden Jungen zuwenden. Gelegentlich verführen sie in ihrem Park fremde Männer, auch wenn das heißt, dass sie sie fesseln müssen. Regie führt der alte Mann in der Nachbarschaft, der ihre Optik stets mit dem Fernrohr beobachtet und begehrt.
Traumartig, rauschhaft und distanziert hält diese Parabel auf weibliches Begehren den Text in einem männlichen distanzierten Blick auf das Schauspiel und die drei konturlosen Frauen. Er möchte dass sie Objekt sind, dass sie faszinierend bleiben und zur gleichen Zeit unter Kontrolle. Doch Serre spickt in ihrem Debüt von 1992 subtile Ausbrüche und Perspektiven, die die männliche Kontrolle irritieren. So bekommt eine Gouvernante einen Sohn und für kurze Zeit entzieht sie sich dem begehrenden Blick. Als alle drei Governanten kurz verschwinden, fragt sich der Voyeur, ob er endlich lieben kann, wenn er von der distanzierten Idealisierung und Objektifizierung befreit ist. Die Gouvernanten verschwinden immer wieder im Park, in ihren Zimmern und am Ende löst sich alles auf.
Es ließ sich viel finden in diesen gehaltvollen 80 Seiten. Entgegen heutiger Lesegewohnheiten wird gänzlich auf eine Innenschau der Figuren verzichtet, auch kommt keine erklärende Erzählstimme zur Hilfe, keine Identifikationsmöglichkeit, keine psychologisch aufgebaute Emanzipation der Figuren, kein expliziter Spannungsbogen. Die angekündigte Verfilmung mit Lilly Depp liegt nahe, denn Die Governanten konzentriert sich auf Szenen und Bilder, ich hoffe sehr, dass sie die Geschichte mit ihren subtilen Brüchen nicht ruiniert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
eBook, ePUB
schräg
Anne Serré ist in Frankreich eine anerkannte Autorin. In Deutschland wurde bisher erst ein Erzählungsband übersetzt, und jetzt kommt mit Die Gouvernanten ihr Debütroman.
Das Buch ist ungewöhnlich, denn diese 3 Gouvernanten verhalten sich nicht wie erwartet. …
Mehr
schräg
Anne Serré ist in Frankreich eine anerkannte Autorin. In Deutschland wurde bisher erst ein Erzählungsband übersetzt, und jetzt kommt mit Die Gouvernanten ihr Debütroman.
Das Buch ist ungewöhnlich, denn diese 3 Gouvernanten verhalten sich nicht wie erwartet. Eleonore, Ines, Laura. Sie halten nichts von Regeln oder Einschränkungen. Sie leben sich aus, auch sexuell. Um die Kinder kümmern sie sich nur sporadisch.
Die Gouvernanten toben und tollen, sind unberechenbar.
Die Autorin setzt das sprachlich in sinnlicher wie rasanter Form um.
So ganz fassbar sind die drei Frauen für mich nicht, aber vermutlich hat die weibliche Leserschaft damit keine Probleme.
Man darf gespannt sein, ob weitere Romane von Anne Serré in deutscher Übersetzung folgen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für