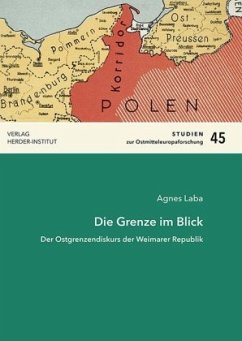Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete für Deutschland neben einer wirtschaftlichen und außenpolitischen Schwächung insbesondere auch Gebietsverluste an beinahe allen Grenzlinien. Vor allem die in Folge des Versailler Vertrags entstandene neue Staatsgrenze im Osten wurde zu einer Projektionsfläche für eine deutsche Nichtakzeptanz der Kriegsniederlage. Die wiederholte Forderung nach ihrer Revision wurde zu einer Art common sense innerhalb der deutschen Gesellschaft, in deren Kontext alternative, vermeintlich richtige Grenzziehungen entworfen wurden, die schon bald Territorien als "rechtmäßig deutsch" deklarierten, die auch am Vorabend des Ersten Weltkriegs kein integraler Bestandteil des deutschen Staatsterritoriums gewesen waren. Ausgehend von einem breiten Revisionskonsens gegenüber dem Friedensvertrag von Versailles analysiert diese Studie den Ostgrenzendiskurs der Weimarer Republik. Indem sie die den Diskurs bestimmenden gesellschaftlichen Akteure, ihre Veröffentlichungskontexte und -strategien sowie die Theorien und Argumentationslinien beschreibt, zeigt die Studie auf, wie sich das Theorem der "ungerechten Ostgrenze" als gesamtgesellschaftlicher Konsens etablieren konnte. Anhand des Ostgrenzendiskurses der Weimarer Republik zeichnet die Untersuchung nicht nur die argumentative Suche einer von Kriegsniederlage und Gebietsabtretungen geprägten Gesellschaft nach einem als rechtmäßig erachteten deutschen Wir-Raum nach, sondern beleuchtet auch das in dieser Phase deutscher Geschichte vorherrschende komplexe Verhältnis der deutschen Territorialdiskurse zum europäischen Osten. Neben Diskussionen der politischen Publizistik und wissenschaftlicher Abhandlungen basiert diese Studie außerdem auf der Auswertung von Landkarten, Schulbüchern und visuellen Quellen der Alltagspublizistik wie Postkarten.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno