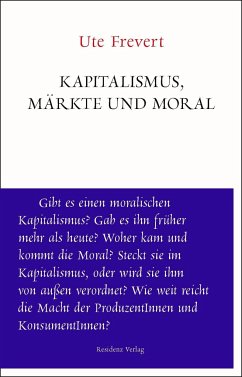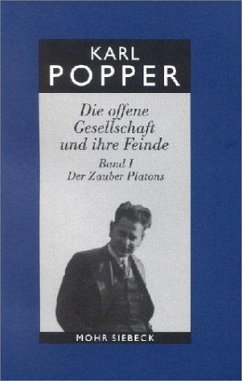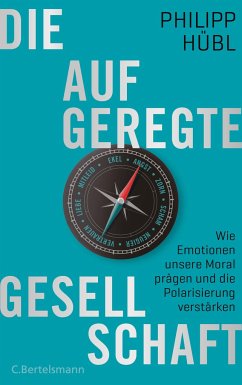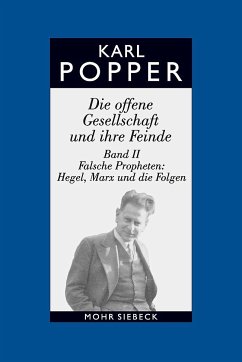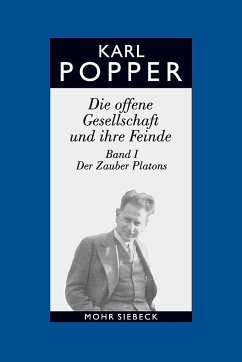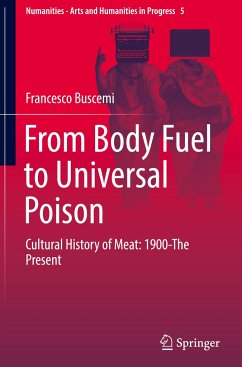Die Grenzen des Sozialen
Zur sozio-technischen Konstruktion von Leben und Tod in der Intensivmedizin. Habil.-Schr.
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
89,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die anthropologischen Grenzfragen nach dem Anfang des menschlichen Lebens und seinem Ende wurden bislang von der Philosophie, Medizin und Theologie behandelt. Hier wird eine neuartige soziologische Perspektive eingenommen. In theoretischer und methodischer Hinsicht bricht die Untersuchung mit der in der Soziologie gültigen Weltinterpretation, wonach nur lebende Menschen soziale Akteure sein können. Auf dieser Grundlage wird der alltägliche Umgang mit Intensivpatienten und die Praxis der Hirntoddiagnostik empirisch beobachtet.Die Untersuchung umfaßt zwei Problembereiche: Epistemologisch geh...
Die anthropologischen Grenzfragen nach dem Anfang des menschlichen Lebens und seinem Ende wurden bislang von der Philosophie, Medizin und Theologie behandelt. Hier wird eine neuartige soziologische Perspektive eingenommen. In theoretischer und methodischer Hinsicht bricht die Untersuchung mit der in der Soziologie gültigen Weltinterpretation, wonach nur lebende Menschen soziale Akteure sein können. Auf dieser Grundlage wird der alltägliche Umgang mit Intensivpatienten und die Praxis der Hirntoddiagnostik empirisch beobachtet.
Die Untersuchung umfaßt zwei Problembereiche: Epistemologisch geht es darum, wie der Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften konstituiert wird. In ethisch-politischer Hinsicht steht im Mittelpunkt, wie die Begrenzung des menschlichen Lebens zu einer naturwissenschaftlichen Frage wird, die durch die Praktiken der Medizin wirksam beantwortet werden kann. Beide Problembereiche sind eng miteinander verbunden. Denn um sehen zu können, wie die medizinische Todesfeststellung die ethisch-politische Grenze zwischen lebenden Menschen und anderem zieht, darf diese in der Analyse nicht vorausgesetzt werden. Die Analyse muß also zunächst ohne Bezug auf eine apriorische Bestimmung dessen auskommen, was menschliches Leben charakterisiert.
Die Untersuchung umfaßt zwei Problembereiche: Epistemologisch geht es darum, wie der Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften konstituiert wird. In ethisch-politischer Hinsicht steht im Mittelpunkt, wie die Begrenzung des menschlichen Lebens zu einer naturwissenschaftlichen Frage wird, die durch die Praktiken der Medizin wirksam beantwortet werden kann. Beide Problembereiche sind eng miteinander verbunden. Denn um sehen zu können, wie die medizinische Todesfeststellung die ethisch-politische Grenze zwischen lebenden Menschen und anderem zieht, darf diese in der Analyse nicht vorausgesetzt werden. Die Analyse muß also zunächst ohne Bezug auf eine apriorische Bestimmung dessen auskommen, was menschliches Leben charakterisiert.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.