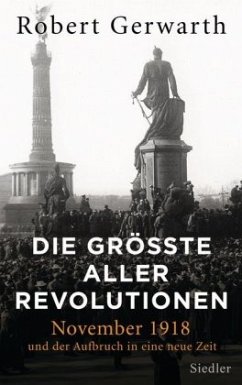Ein neuer Blick auf ein epochales Ereignis deutscher Geschichte
Die deutsche Revolution von 1918 - sie gilt noch heute als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nazis und zur Katastrophe ermöglichte. Ein Fehlurteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth schildert die dramatischen Ereignisse zwischen den letzten Kriegsmonaten 1918 und dem Hitlerputsch 1923 und beschreibt dabei, wie grundlegend und nachhaltig die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.
Die deutsche Revolution von 1918 - sie gilt noch heute als gescheitert. Eine verpasste Chance, die den Weg zum Aufstieg der Nazis und zur Katastrophe ermöglichte. Ein Fehlurteil, wie der renommierte Zeithistoriker Robert Gerwarth zeigt. Nicht nur zerschlug die Revolution die autoritäre Monarchie der Hohenzollern, sie schuf auf erstaunlich unblutige Weise den ersten deutschen demokratischen Nationalstaat. Gerwarth schildert die dramatischen Ereignisse zwischen den letzten Kriegsmonaten 1918 und dem Hitlerputsch 1923 und beschreibt dabei, wie grundlegend und nachhaltig die Novemberrevolution Deutschland veränderte. Denn wer das Geschehen nur vom Ende her betrachtet, ignoriert, wie sehr die Zukunft damals offen war.

Wie Friedrich Ebert die revolutionäre Energie kanalisierte: Robert Gerwarth deutet den Umsturz im November 1918
Zehn Jahre nach Revolution und Republikgründung klagte Kurt Tucholsky in der "Weltbühne" über das Auseinanderklaffen von "Ideal und Wirklichkeit". In dem so betitelten Spottgedicht hieß es: "Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik . . . und nun ists die! Man möchte immer eine große Lange, und dann bekommt man eine kleine Dicke - Ssälawih!" Bei aller Kritik, die Tucholsky an der Weimarer Republik übte, hätte er als prinzipieller Anhänger der Demokratie wohl kaum bestreiten mögen, dass die "kleine Dicke" einen großen Fortschritt gegenüber den politischen Zuständen des Kaiserreichs bedeutete. Robert Gerwarth jedenfalls kann der "kleinen Dicken" einiges abgewinnen. Dies fällt ihm umso leichter, als er schon dem "großen Dicken" Anerkennung zollt.
So mag man in Anlehnung an Tucholskys satirische Zeilen, ohne Gewähr für genaue Werte zum Body-Mass-Index, die Leitfigur des revolutionären Übergangs von 1918/19 nennen: Friedrich Ebert. Rund um seine Person entflammten von Anfang an Kämpfe zur Deutung der Novemberrevolution. Früh galt er seinen Feinden zur Rechten als Vaterlandsverräter, der durch illoyales Handeln an der "Heimatfront" mitverantwortlich für das deutsche Kriegsdebakel sei. Seine Gegner zur Linken schmähten ihn als Arbeiterverräter, der Rätemodelle abgelehnt, mit den alten Eliten paktiert habe und vor dem Einsatz militärischer Gewalt gegen Teile der Arbeiterbewegung nicht zurückgeschreckt sei.
Gerwarth dagegen lobt Ebert, der an der Spitze einer unerfahrenen Regierung und unter ungünstigen Ausgangsbedingungen Beachtliches geleistet habe. Ihm sei das "Kunststück" geglückt, die "revolutionäre Energie zu kanalisieren" und Deutschland in eine parlamentarisch-demokratische Ordnung mit einer liberalen Verfassung zu überführen. Er bevorzugte den Weg der Reform gegenüber einer grundstürzenden Revolution, die ihn Unordnung und Chaos, gar "russische Verhältnisse" befürchten ließen.
Diese waren seit 1917, als die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten und eine Avantgarde von Berufsrevolutionären in Russland den Bolschewismus an die Macht beförderte, kein Hirngespinst, sondern eine reale Gefahr. Vor diesem Hintergrund interpretiert Gerwarth das oft zitierte Diktum Eberts von der Revolution, die er wie die Sünde hasse, nicht als konservative Beharrlichkeit, sondern als Ablehnung einer "kommunistischen Revolution", die auf Gewalt und die Herrschaft einer Minderheit setzte.
Eine verzerrende Sichtweise erkennt der Dubliner Historiker auch in der These, Ebert habe mit seiner Begrüßung der Frontsoldaten vor dem Brandenburger Tor am 10. Dezember 1918 mit den Worten "kein Feind hat Euch überwunden" die "Dolchstoßlegende" befördert. Nach seiner Ansicht zielte Ebert vielmehr darauf, die Kriegsheimkehrer "für das neue Regime" einzunehmen. Schließlich hält Gerwarth es für abwegig, in Absprachen zwischen der Übergangsregierung und der Obersten Heeresleitung - in einem Telefonat zwischen Ebert und dem Ersten Generalquartiermeister Wilhelm Groener am 10. November 1918 - einen "faustischen Pakt" auszumachen. Nüchtern nennt er diesen Vorgang stattdessen eine "pragmatische Übereinkunft" aus beiderseitig nachvollziehbaren Gründen.
Wer darin eine unkritische Darstellung gegenüber dem Rückgriff auf militärische Kräfte seitens der Regierung ab der Jahreswende 1918/19 erkennen möchte, täuscht sich allerdings. Hart geht Gerwarth mit Gustav Noske, der sich selbst als "Bluthund" bezeichnete, und mit den von ihm eingesetzten Freikorps ins Gericht. Wie sehr deren Sitten verrohten und sie zu blutigen Exzessen neigten, die der Bezeichnung eines "weißen Terrors" durchaus entsprachen, verdeutlicht Gerwarth am Beispiel marodierender Freischärler im Baltikum.
Eine andere Frage ist, ob die Erkenntnisse über Gewalthandlungen in den Bruchzonen des alten Imperiums sich ohne weiteres auf die Verhältnisse in den Zentren des Deutschen Reichs übertragen lassen. Neuere Studien zur frühen republikanischen Wehrpolitik fordern eine differenziertere Betrachtung und warnen davor, die Selbstheroisierungen von während der NS-Zeit verfasster autobiographischer Freikorpsliteratur als Tatsachenberichte zu übernehmen. Als einer der besten Kenner gewaltgeschichtlicher Prozesse in den Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs ist Gerwarth vor solchen Kurzschlüssen gefeit. Diese neue Dimension politischer Gewalt hat der Autor vor wenigen Jahren in seinem viel beachteten Werk "Die Besiegten" genau dargelegt.
Immer wieder leuchten seine früheren Ausführungen in das neue Buch hinein und erhellen so die deutschen Ereignisse mit international vergleichenden Überlegungen. Die deutsche Entwicklung gerät zugleich in ein milderes Licht, in dem die Auswüchse einer brutalen physischen Gewalt vergleichsweise gering ausgeprägt erscheinen. Auch widerstand die Weimarer Demokratie trotz des Versailles-Traumas einer autoritären Kehre besonders lange. Wer über die Binnenperspektive der gemäßigten deutschen Revolution hinausblickt, das ist eine zentrale These Gerwarths, wird ihre Errungenschaften deutlicher sehen und ihre Versäumnisse weniger stark ins Gewicht fallen lassen.
Auf die alte Streitfrage nach versäumten Möglichkeiten und besseren Alternativen einer ungeschehenen Geschichte lässt er sich nicht ein. Das ist wohltuend: eine schnörkellose Darstellung ohne ständiges Hätte, Wenn und Aber. Von einer retrospektiven Geschichte im Wunschmodus, wie er gerade Revolutionsdeutungen prägt, hält Gerwarth wenig. Die Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen der Zeitgenossen dagegen kommen bei ihm deutlich zur Geltung. Nicht zuletzt intellektuelle Zeitdiagnostiker, die er ausgiebig zitiert, lassen ein lebendiges Zeitkolorit entstehen - ob Harry Graf Kessler, Victor Klemperer, Alfred Döblin oder Thomas Mann, vor allem aber Käthe Kollwitz, deren feinfühligen, skrupulösen Tagebuch-Notizen eine Quelle von hervorragendem Wert sind. So sehr die Künstlerin ihre Argumente mit Bedacht hin- und herwendete, begrüßte sie doch den Wandel, war froh über das Ende des Krieges, freute sich über das neue Frauenwahlrecht und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft. Dass sie Zeugin einer Revolution geworden war, daran bestand für sie kein Zweifel.
Aber war es die "größte aller Revolutionen", wie der einem berühmten Zitat des liberalen Journalisten Theodor Wolff entlehnte Buchtitel suggeriert? Gerwarth weicht einer direkten Antwort aus, liefert jedoch in der ausführlichen Einleitung eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, in dem Umbruch 1918/19 eine bedeutende Revolution zu erkennen. Er nennt das hohe politische wie auch ein beachtliches - von ihm nur angedeutetes - soziales und kulturelles Veränderungspotential, schließlich das im grenzüberschreitenden Vergleich geringe Gewaltniveau. Zugleich sensibilisiert diese Studie dafür, Revolution in modernen Gesellschaften nicht vorrangig über bewaffnete Aufstände und Barrikadenkämpfe zu definieren. Eigentlich revolutionär erscheint vielmehr die Einführung und Durchsetzung neuer politischer Prinzipien, erweiterter Partizipations- und Bürgerrechte.
Die Weimarer Verfassung fixierte sie und gab so der "wohl fortschrittlichsten Republik der Zeit" in einem Dokument Ausdruck: einer Republik, die als "Triumph des Liberalismus" doch ein zu überschwängliches Lob erfährt. Entgegen manch späterer Behauptung war sie aber keineswegs wehrlos, wie Gerwarth zu Recht in seinem Ausblick bis 1923 betont. Am Ende dieses Krisenjahres habe Deutschland in eine unvorhersehbare Zukunft geblickt.
Weimar als entwicklungsoffene Angelegenheit, das ist so etwas wie der neue historiographische Deutungskonsens zur Novemberrevolution - einer Revolution, um die weniger hitzig als in früheren Jahren gestritten wird. Die Offenheitsthese ist dabei so offen, dass sie nicht für eine neue Meistererzählung taugt. Gerwarth strebt sie erst gar nicht an, beschränkt sich stattdessen auf einen "synthetisierenden Debattenbeitrag". Der allerdings bietet gut lesbare Orientierung, vermittelt zeitgenössische Stimmungsbilder und gewichtet die deutschen Vorgänge im internationalen Kontext.
ALEXANDER GALLUS
Robert Gerwarth: "Die größte aller Revolutionen". November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit.
Siedler Verlag, München 2018. 384 S., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Alexander Gallus schätzt Robert Gerwarths Darstellung der Revolution von November 1918 als lesbare Orientierung mit lebendigen Stimmungsbildern, etwa durch die O-Töne von Döblin bis Kollwitz, und die Gewichtung der deutschen Lage im internationalen Zusammenhang. Dass der Autor Weimar als ergebnisoffene Sache betrachtet, ohne daraus ein neues Narrativ zu formulieren, gefällt Gallus. Dass Deutschland bei Gerwarth in milderem Licht erscheint und er nicht nach versäumten Chancen fahndet, findet der Rezensent in Ordnung. Dafür bekommt er auch ein schärferes Bild der zeitgenössischen Erwartungen und Enttäuschungen und kann Revolution künftig anders definieren denn als bewaffneten Aufstand, als politische Bürgersache nämlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein sehr lesenswertes und leicht zu lesendes Buch... Das Einweben von Zeitzeugenberichten wie den Tagebüchern von Käthe Kollwitz oder Victor Klemperer ist ein großer Gewinn.« WDR 3 Mosaik
»Gerwarth bietet gut lesbare Orientierung, vermittelt zeitgenössische Stimmungsbilder und gewichtet die deutschen Vorgänge im internationalen Kontext.« Frankfurter Allgemeine Zeitung