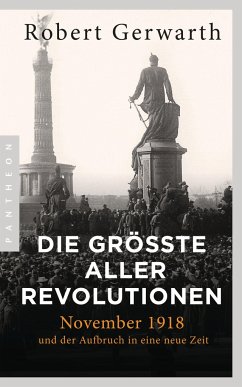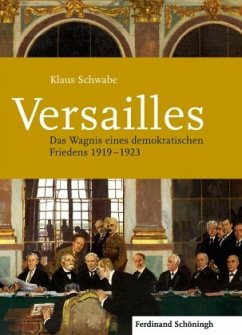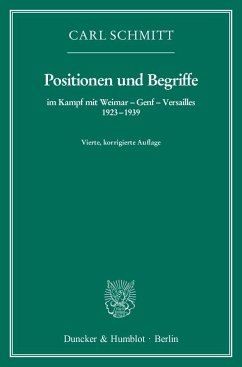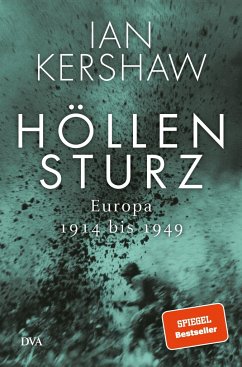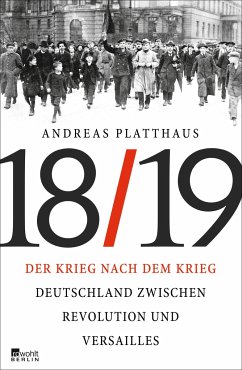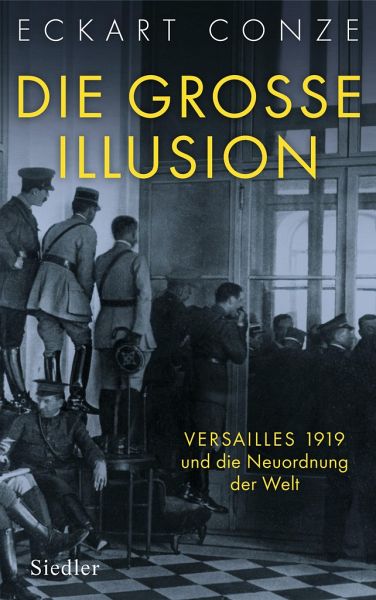
Die große Illusion
Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Frieden, den keiner wollte: Der Versailler Vertrag und seine FolgenDer Versailler Vertrag hat die Welt geprägt bis heute - alte Reiche versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die a...
Der Frieden, den keiner wollte: Der Versailler Vertrag und seine Folgen
Der Versailler Vertrag hat die Welt geprägt bis heute - alte Reiche versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die alliierten Sieger noch das geschlagene Deutschland und die anderen Verlierer waren bereit, wirklich Frieden zu machen. Auf allen Seiten ging auch nach dem Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter, mit verheerenden Folgen. Versailles - das war der Frieden, den keiner wollte.
Ausstattung: mit Abbildungen
Der Versailler Vertrag hat die Welt geprägt bis heute - alte Reiche versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die alliierten Sieger noch das geschlagene Deutschland und die anderen Verlierer waren bereit, wirklich Frieden zu machen. Auf allen Seiten ging auch nach dem Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter, mit verheerenden Folgen. Versailles - das war der Frieden, den keiner wollte.
Ausstattung: mit Abbildungen