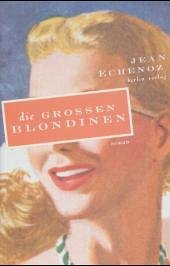Was ist aus Gloria Stella geworden, Star des Pariser Show-Business, die wegen Totschlags an ihrem Manager und Geliebten im Gefängnis saß und seit ihrer Entlassung wie vom Erdboden verschluckt ist? Der Filmproduzent Paul Salvador und seine überaus reizvolle Assistentin Donatienne möchten sie in einem geplanten TV-Feature über die "Großen Blondinen" neben dem klassischen magischen Dreieck Marlene, Marilyn und BB präsentieren. Detektive werden auf ihre Spur gesetzt, Jean-Claude Kastner, der sie in der Bretagne aufspürt, bezahlt es als Erster mit seinem Leben. Gloria Stella - ein sprechender Name wie aus dem Comic - entzieht sich, begleitet von ihrem Schutzengel und Dämon Bleliard, nach Sydney, Bombay und Südindien, wo sie in dunkle Geschäfte verwickelt wird, die sie schließlich als Begleiterin von Pferdetransporten - es ist viel Platz in Pferden für Drogen und Zäsium - nach Frankreich zurückführen. Aufbruch, Suche und Verfolgung sind der Motor des Geschehens, das nach einer letzt enüberraschend-burlesken Wendung mit einem wunderbar kitschigen Happy End in Hollywood schließt. Die großen Blondinen sind Abenteuerroman, Krimi mit einem Schuss Ian Fleming und literarischer Comic zugleich.

Färben hilft nicht, Herr Echenoz: Die Postmoderne ist vorüber
Es gibt einen Film, der heißt "Amores Perros" und erzählt von der Schnittstelle von Schönheit und Gefährdung, die sich in der modernen Gesellschaft im Typus der Blondine am besten abbilden läßt. Und es gibt ein Buch, das heißt "Die großen Blondinen" und erzählt von der Oberfläche von Schönheit und Gefährdung, die sich in der postmodernen Gesellschaft im Typus der Blondine am besten bebildern läßt. Zwischen beiden Werken liegen Welten - ein Zeitensprung, eine Kontinentaldrift, ein Globalisierungsschock. Der Film ist aus Mexiko, das Buch aus Frankreich; der Film ist aus dem Jahr 2000, das Buch aus dem Jahr 1995; der Film bohrt sich tief ins Gedächtnis, weil er sich in die Wirklichkeit verbeißt wie einer der Kampfhunde, von denen er handelt; das Buch entgleitet einem beim Lesen wie eine Sommerbrise, die über die Terrasse streicht.
Vielleicht ist es das Problem des Romans von Jean Echenoz, daß er erst jetzt auf deutsch erscheint; vielleicht ist es ganz einfach die Schuld des Verlages. In jedem Fall hinkt die sich so leichtfüßig gebende Geschichte um den Fernsehproduzenten Paul Salvador und die Blondine Gloire Stella so gewaltig ihrer Zeit hinterher, daß es den Eskapismus der augenzwinkernden Art, der das ganze Werk von Echenoz durchzieht, überhaupt in ein zweifelhaftes Licht rückt. Waren es die Jahre damals, die achtziger und neunziger Jahre, in denen wir auf jede Täuschung so gern hereingefallen sind, in denen wir uns in den Spiegelkabinetten der Wirklichkeit wohl fühlten, in denen wir fremde Lügen für unsere eigenen Träume hielten?
Und was mußte passieren, daß der Einbruch der Wirklichkeit, wie ihn die aufregende, blutige, tragische Geschichte um das gefallene blonde Model Valeria in "Amores Perros" schildert, wie eine Befreiung wirkte, wie ein Windstoß, der alte Gewißheiten zerstreute, die sich in unseren Köpfen angehäuft hatten? Buch und Film wurden dem deutschen Publikum innerhalb von wenigen Monaten Abstand präsentiert. Das Buch funktioniert wie ein Spiegel, den der Autor absichtlich auf den Boden geworfen hat - und nun wundert er sich, daß in diesem Scherbenhaufen kein Teil zum anderen paßt; der Film schildert ganz einfach eine Welt, die zerbrochen ist. Das Buch steckt mitten in der Postmoderne fest; der Film hat diese längst überwunden.
Den Vergleich mit dem Kino muß Echenoz aushalten - er sucht ihn ja selbst. Mit seinen Geschichten und Figuren beschwört er einen schönen, leeren Wohlstandskosmos, in dem die Menschen vor lauter fremdgesteuerten Bildern das eigene Leben aus dem Blick verlieren. Kunstwelten, Fernsehwelten, Sekundärwelten. Mit diesen Fluchtphantasien von Menschen, die im Packeis der postmodernen Biographien verfangen sind, ist der Franzose bekannt geworden. Félix Ferrer etwa, der Pariser Kunsthändler, der sich in Echenoz' letztem Roman "Ich gehe jetzt" auf eine Reise macht in die Polarhölle, um so dem ewigen Kreislauf des Alltags zu entkommen - und der am Ende seiner abenteuerlichen Tour doch wieder dort landet, von wo er aufgebrochen ist. In "Die großen Blondinen" wirkt es nun so, als schaue man jemandem zu, der rennt und rennt und dabei kein bißchen von der Stelle kommt.
Echenoz ist ein Stillstandsvirtuose, dessen Romanen man förmlich anmerkt, wie ihr Autor sich über seine Sprachspielereien freut. Er ist so stolz auf seine Tricks und Kniffe, daß er nicht merkt, wie gespreizt vieles wirkt. Dabei fragt man sich, warum einen diese Abenteuerposse um Salvador, seine Assistentin Donatienne und die verschollene Stella überhaupt interessieren soll. Sie ist so pappig, zäh und betäubend wie ein Nachmittag in Bombay, wo man, wie Echenoz schreibt, "durch einen kompakten Block aus Gerüchen mit vorherrschend zuckriger Note" wandert, "so dicht wie ein Kumolonimbus von variabler Geometrie".
Da beauftragt also der Produzent Salvador einen Privatdetektiv, um für seine Serie über berühmte Blondinen den gefallenen Stern Stella zu finden, die in der Provinz an unbekanntem Ort ein tristes Rückzugsleben führt und ein dunkles Geheimnis hütet. Der erste Detektiv, der ihr auf die Spur kommt, fällt von einer steilen Klippe, ein anderer von einer hohen Brücke. Über Länder und Kontinente geht die Flucht von Stella, die von einem diabolischen Helfer namens Béliard begleitet wird. Er ist so groß wie ein Lineal und hockt ihr gern auf der Schulter. Paris, Bombay, Sydney - eine Flucht ohne Grund, denn die Ironie liegt in der Konstellation, daß die Unglücksmaschine von einem Mann angetrieben wird, der im Grunde kein wirkliches Interesse daran hat, Stella zu finden. Natürlich enden sie trotzdem bei der Liebe: Wenn ein Autor schon gerne mit den Klischees spielt, dann bitte auch mit den französischen.
Aus den grauen Plastikwelten der französischen Vorstädte speist sich das Personal dieses Buchs, Supermarktexistenzen, stapelbare Charaktere - aber was sich als avanciertes unpsychologisches Erzählen gibt, ist hier im Resultat nur belanglos und läppisch. "Wer ihre Gesichter, ihre Körper sieht", heißt es am Ende, "dem scheint es, als verspürten die beiden jetzt keinerlei Sorge, keinerlei besonderen Schmerz. Er ängstigt sich nicht mehr vor der Höhe, sie hat vor gar nichts mehr Angst." Von Angst war auf den 189 Seiten davor aber gar nichts zu merken. Angst wäre immerhin ein Antrieb.
GEORG DIEZ
Jean Echenoz: "Die großen Blondinen". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Berlin Verlag, Berlin 2002. 190 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Wie eine Sommerbrise, die über die Terrasse streicht, ist Rezensent Georg Diez dieses Buch entglitten: und das ist kein Kompliment. Denn der Rezensent sieht die sich so leichtfüßig gebende Geschichte um einen Fernsehproduzenten und eine Blondine so gewaltig ihrer Zeit hinterherhinken, dass für ihn plötzlich Echenoz' ganzes Werk fragwürdig wird. Mit seinen Geschichten beschwört er einen schönen, leeren Wohlstandskosmos, schreibt Diez, in dem die Menschen vor lauter fremdgesteuerten Bildern das eigene Leben aus den Augen verlören. Aus "den grauen Plastikwelten der französischen Vorstädte" speist sich für Diez denn auch das Personal dieses Buches. Doch was sich als "avanciertes unpsychologisches Erzählen" gibt, findet er im Resultat oft gespreizt, meist aber nur belanglos und läppisch.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"